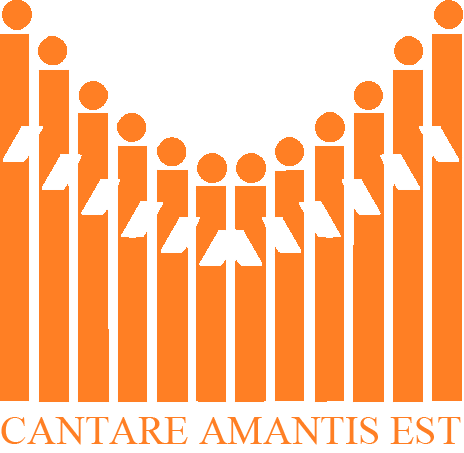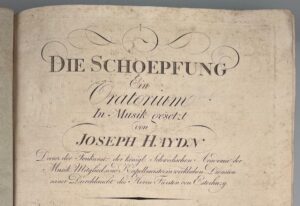Im Mai gestalten wir nicht nur viermal die Liturgie in den Hochämtern der Jesuitenkirche mit, sondern geben auch erstmals seit langer Zeit wieder ein Konzert mit Chor, Solisten und Orchester. Haydns „Die Schöpfung“ aufzuführen, ist schon ein Grund zur Freude; aber die Vorfreude wird noch größer angesichts des großartigen Solistentrios, das mit uns musizieren wird!
Dieses möglicherweise berühmteste Werk Haydns wurde für den Konzertsaal geschrieben und mit größtem Erfolg hauptsächlich auch in solchen in ganz Europa aufgeführt. Die Aufführung im akustisch wunderbaren Raum der Jesuitenkirche verleiht diesem Oratorium eine noch einmal tiefere religiöse Dimension. Bei einer Aufführung im März 1808 erklang „Die Schöpfung“ in einer italienischen Übersetzung unter der Leitung von Antonio Salieri gleich nebenan, im Festsaal der Neuen Aula der (Alten) Universität. Der schon greise 76-jährige Haydn wurde da bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte von Komponistenkollegen und Publikum bejubelt.
Näheres dazu ist in einem durchaus informativen Wikipedia-Beitrag (s.u.) nachzulesen, zu dem wir im Text zum Werk ausnahmsweise verlinken. Solche Beiträge oft unbekannter Autorenschaft, die wir im Newsletter öfter zitieren, sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Wir greifen in die Originaltexte nur bei offensichtlichen Irrtümern/Schreibfehlern ein, nicht aber inhaltlich. Dadurch kann es vorkommen, dass wir hier vereinzelt Aussagen abdrucken, die überholt oder in früheren Beiträgen bereits widerlegt sind. – Ein Beispiel? Bernhard Neuhoff von BR-Klassik schreibt in seinem launigen Beitrag über die Krönungsmesse, „Irgendwann muss die Messe mal bei einer Krönung verwendet worden sein.“ – Nun, dieser Sachverhalt ist recht gut dokumentiert, bzw. gut nachvollziehbar, und bedarf eigentlich keiner flapsigen Vermutung.
Der Autor des Beitrages über die Spatzenmesse verfügt über vermeintlich tiefe Einblicke in Mozarts innere Beweggründe, wenn er den bekannten Umstand kommentiert, dass Fürsterzbischof Colloredo keine Messen mit einer Gesamtdauer von über 45 Minuten wollte: „Mozart aber sah darin keine Gängelei, sondern Herausforderung“. – Das ist, bei allem Respekt, ziemlich hanebüchen. Dass Mozart wohl das Beste aus dieser Einschränkung gemacht hat: zweifellos; aber sie wird ihm schon auch ordentlich auf die Nerven gegangen sein.
Der Kirchenrektor hierzulande hat nichts gegen Hochämter, die doppelt so lange dauern. Hier gibt es definitiv keine Gängelei. Wolfgang Amadé hätte seine Freude gehabt!
Martin Filzmaier
Sonntag, 4. Mai 2025, 10:30 Uhr:
W. A. MOZART: Missa solemnis in C-Dur – „Krönungsmesse“ KV 317
 „Krönungs-Messe“ – das klingt einprägsam, das kann man sich merken. Vielleicht war es nicht zuletzt dieser zugkräftige Beiname, der Mozarts C-Dur-Messe KV 317 zu einer seiner beliebtesten Mess-Vertonung gemacht hat. Dabei schrieb Mozart seine sogenannte „Krönungsmesse“ für einen ganz normalen Ostergottesdienst. Gekrönt wurde an Ostern 1779 im Salzburger Dom niemand. Woher der Beiname stammt? Irgendwann muss die Messe mal bei einer Krönung verwendet worden sein. Viel interessanter ist, was es mit Mozarts Musik auf sich hat.
„Krönungs-Messe“ – das klingt einprägsam, das kann man sich merken. Vielleicht war es nicht zuletzt dieser zugkräftige Beiname, der Mozarts C-Dur-Messe KV 317 zu einer seiner beliebtesten Mess-Vertonung gemacht hat. Dabei schrieb Mozart seine sogenannte „Krönungsmesse“ für einen ganz normalen Ostergottesdienst. Gekrönt wurde an Ostern 1779 im Salzburger Dom niemand. Woher der Beiname stammt? Irgendwann muss die Messe mal bei einer Krönung verwendet worden sein. Viel interessanter ist, was es mit Mozarts Musik auf sich hat.
„Sie wissen, bester Freund, wie mir Salzburg verhasst ist! Salzburg ist kein Ort für mein Talent.“ Mit Händen und Füßen sträubt sich Mozart – doch es hilft nichts. Nachdem die große Reise nach Mannheim und Paris gescheitert ist, bleibt ihm nur eins: die Rückkehr nach Salzburg in den verhassten Dienst beim Fürst-Erzbischof Colloredo. Mozart meckert: „Ich schwöre Ihnen bey meiner Ehre, dass ich Salzburg und die Einwohner nicht leiden kann; mir ist ihre Sprache, ihre Lebensart ganz unerträglich!“
Erst recht der Erzbischof selbst – pardon: der Erzlümmel, wie Mozart ihn nennt. Der zahlt seinem aufsässigen Hoforganisten 450 Gulden im Monat (ca. 10.000 €) – und bekommt dafür frische Kompositionen. Im Februar 1779 bewirbt sich Mozart um diesen zweitklassigen Posten in einer zweitklassigen Residenzstadt. Einen Monat später liefert er pflichtgemäß eine neue Messe – eine erstklassige, versteht sich.
Pauken und Trompeten bestimmen den Klang der C-Dur-Messe, der sogenannten Krönungsmesse. Schon daran kann man ablesen, wer am Ostersonntag des Jahres 1779 im Salzburger Dom zelebrierte: Der Erzlümmel, pardon: der Erzbischof selbst.
Keine Spur von mangelnder Motivation also – und das, obwohl Mozart weder mit seinem Posten noch mit dem Auftraggeber glücklich war. Dass seine Kirchenmusik im Schatten der Opern und Klavierkonzerte steht, bedeutet eben keineswegs, dass er keine Lust darauf gehabt hätte. Nur hatte er später kaum noch Gelegenheit, für den Gottesdienst zu komponieren.
Das Credo beginnt mit einem markanten Motiv auf einem einzigen Ton. Es ist, als würden die Trompeten den Text mitsprechen: Credo in unum deum, ich glaube an den einen Gott. Immer wieder beharren die Trompeten auf diesem Motiv, das auch bei den anderen Glaubensartikeln wie ein Refrain wiederholt wird. So wird dem Hörer immer wieder eingeschärft, worum es hier geht: um ein Bekenntnis, das jeden Zweifel ausschließt – eben um ein Credo. Im Credo spricht die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche mit all ihrer Prachtentfaltung in der Fülle ihrer Macht. Schließlich war Erzbischof Colloredo ein Fürst von Gottes Gnaden.
Im Agnus Dei dagegen, dem letzten Satz der Messe, spricht ein Individuum von seinen innersten Gefühlen. Vielleicht ist kein Zufall, dass sich Mozart sechs Jahre später, als er den „Figaro“ schrieb, an seine C-Dur-Messe erinnerte. Die Arie der Gräfin aus dem dritten Akt ist ein klarer Fall von Selbstplagiat. Musikalisches Recycling war nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Vielleicht fand Mozart, dass sein Einfall viel zu schade war, um ihn nur einmal zu verwenden – schließlich konnte er nicht ahnen, dass die Krönungsmesse viele hundert Jahre später eine der beliebtesten Messvertonungen überhaupt sein würde.
Das Agnus Dei ist ganz einfach ein schlagender Beweis für Mozarts Genie: Musik sollte das Herz erreichen, und genau das erreicht Mozart mit diesem Agnus Dei. Er war wirklich in der Lage, mit wenigen Tönen etwas unglaublich Schönes zu erreichen. Die Krönungsmesse ist die einzige von Mozarts großen Messen, die vollständig vorliegt. Schon darum ist sie ein wichtiges Stück. Und jeder ist glücklich, wenn man sie aufführt: das Publikum, das Orchester, der Chor – jeder ist glücklich bei dieser wunderschönen Musik.
Text: von Bernhard Neuhoff BR-Klassik (25.10.2022)
Als Solisten wirken mit: Miriam Kutrowatz, Martina Steffl, Alexander Kaimbacher, Klemens Sander
Mittwoch, 14. Mai 2025, 19:30 Uhr: ABENDKONZERT
Joseph HAYDN : „Die SCHÖPFUNG“
Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sch%C3%B6pfung findet sich gut zusammengefasst alles, was man formal zum Werk wissen sollte.
Inhaltlich muss einem freilich klar sein, dass Haydn nicht eine tiefe theologische Reflexion über den Inhalt des 1. Buchs Mose vertont hat, sondern eine dem damaligen Zeitgeist aus beschaulicher Frömmigkeit geschuldete märchenhafte Nacherzählung des biblischen Inhalts. Man mag kritisieren (oder unterstellen?), dass auch Haydn und der Textautor Lidley die biblische Bildsprache als historischen Bericht missverstehen, wie das noch heute (oder heute wieder) in evangelikalen Kreisen als unverrückbare Wahrheit gesehen wird: Gott machte vor 6000 Jahren in 6x 24 Stunden (am siebenten Tage ruhte Gott) die ganze Welt und den Menschen (wobei Adam und seinen Nachkommen eine Rippe fehlen müsste, denn sie wurde ja dazu verwendet, Eva zu schaffen). Doch während die evangelikalen Häretiker an dieser Entstellung von biblischer Bildersprache hängen bleiben und es gegen ein naturwissenschaftliches Verständnis der Weltentstehung ausspielen, findet Haydn durch die Musik unter Beibehaltung des frommen Textes wieder in die Intention biblischer Ausdrucksweise zurück. Die Farbigkeit der musikalischen Gestaltung erlaubt wieder eine Vertiefung in die Bildsprache der heiligen Schriften hinein und ermöglicht so eine Überhöhung des Textes weg vom buchstäblichen Verständnis, dessen Irrweg nicht scharf genug kritisiert werden kann.
Mein Lehrer Karl Augustinus Wucherer-Huldenfeld OPraem meinte zur Schöpfung der Eva einmal, dass das Bild mit der Entnahme von Adams Rippe, aus der sie geschaffen ist, uns sagen soll, dass beide aus demselben Holz (ein für uns zeitgemäßeres Bild) geschnitzt und somit ebenbürtig sind. – Und was sagt der Evangelikale dazu? – „Ja, sie ist ja nicht aus Holz, sondern aus Knochenmasse gemacht“. – Da kann man dann eigentlich gar nichts mehr dazu sagen.
Ob Haydn und die Zeitgenossen sich tatsächlich über solch ein buchstäbliches Schriftverständnis erheben konnten, lässt sich heute nicht mehr sicher sagen. Die Musik hilft dazu aber jedenfalls sehr. Und am Ende steht doch eines ganz deutlich: der ständige jubelnde Lobpreis Gottes für die Herrlichkeit der Schöpfung durch den Chor, der hier die ganze Menschheit repräsentiert.
MF
Solisten: Cornelia Horak, Sopran; Daniel Johannsen, Tenor; Stefan Zenkl, Bass
Leitung: Andreas Pixner
Kartenvorverkauf (bis 11.5.): Die Sitzplätze sind nummeriert!
Tel.: 0664-336 64 64
bestellung@chorvereinigung-augustin.com
Ab 27.4. auch nach dem Gottesdienst beim Ausgang
Kat. A: Vorverkauf: 35,- Abendkasse: 40,- (Reihe 1-16)
Kat. B: Vorverkauf: 25,- Abendkasse: 30,- (Reihe 17-22)
Sonntag, 18. Mai 2025, 10:30 Uhr:
W.A.MOZART – „Spatzenmesse“ KV 220
Landauf, landab wird die Spatzenmesse von W. A. Mozart musiziert. Warum aber erfreut sie sich solch großer Beliebtheit? Ein kleiner Einblick in Geschichte und Aufbau…
Entstanden ist sie wahrscheinlich zwischen 1775 und 1776, in der Zeit, als Wolfgang Amadeus Mozart Konzertmeister am Salzburger Hof war. Und sie ist in mehrere Hinsichten etwas Besonderes: Zum einen ist die Missa in C, KV 220, liebevoll „Spatzenmesse“ genannt, des Meisters erste „Missa Brevis et Solemnis“. Dies bedeutet eine Mischform aus Stilelementen beider musikalischer Formen. Wohl also ist eine solche Ordinariumsvertonung kürzer gefasst in Faktur und Umfang, mit nur sehr knapp gehaltenen Gesangssoli als kurze Einwürfe in das chorisch beherrschte musikalische Geschehen, sowie ohne Arien (wenn in dieser Messe auch das Benedictus deutlichen Ariencharakter trägt). Dies war nötig, weil auf Geheiß des damals amtierenden Salzburger Fürsterzbischofs Hieronymus Graf von Colloredo ein Hochamt nicht länger als 45 Minuten dauern durfte. Mozart aber sah darin keine Gängelei, sondern Herausforderung, und bereicherte die Messe durch Pauken, Trompeten und – fakultativ – drei Posaunen wie ein Fagott als Gesangsstütze.
Ebenfalls neu in Mozarts Messeschaffen ist die zyklische Anlage. Diese musikalische Geschlossenheit wird erreicht durch den Rückgriff auf die Kyrie-Motivik im Agnus Dei. Übrigens – und dies ist die dritte Besonderheit – besitzt die Spatzenmesse durch und durch volkstümlichen Charakter mit einprägsamen Themen und einfacher musikalischer Struktur. Das heißt: keine ausufernden kontrapunktischen Finessen oder gar Fugen etwa in Gloria und Credo, sondern vielmehr empfindsame Melodik in Solo- und Chorpartien.
Des Weiteren liegt ein vollkommen eigenständiger Orchesterpart vor, der zumindest in Gloria und Credo den musikalischen Motor darstellt – durch ostinate Rhythmen und Figuren. Gängiges Stilmittel seit etwa 1700, erzeugt diese Praktik weitere Einheit und formale Geschlossenheit. Mindestens ebenso üblich in der süddeutsch-österreichischen Musiziertradition ist die Streicherbesetzung des „Kirchentrios“ aus zwei Violinen sowie Cello und/oder Kontrabass, in jedem Falle ohne Viola. Das jugendliche Opus Mozarts verdankt seinen Spitznamen „Spatzenmesse“ schließlich den Violinfiguren in Sanctus und Benedictus, welche an Vogelgezwitscher erinnern.
(Text aus dem Internet, Autor unbezeichnet)
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Martina Steffl, Gernot Heinrich, Yasushi Hirano
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Ave Maria“ von Jaques Arcardelt (1507-1568)
Sonntag, 25. Mai 2025, 10:30 Uhr:
Joseph HAYDN – „Große Orgelsolomesse“
Im Vergleich zur „Jugendmesse“ und zur „Mariazellermesse“ kommt in der „Großen Orgelsolomesse“ ein ganz anderer Charakter zum Tragen. Ludwig Finscher schreibt: „Modern wirkt der auf weite Strecken geradezu idyllische Tonfall, der außer in den Credo-Teilen zur Menschwerdung und Passion alle scharfen Akzente vermeidet, und die – nicht zuletzt dank der Englischhörner – wunderbar farbigen Instrumentation.“
Die Wahl der Tonart Es-Dur, überaus selten als Grundtonart einer Messvertonung der Klassik, steht in Zusammenhang mit der Instrumentierung. Durch die beiden Englischhörner erhält das Werk einen überaus farbigen Charakter, ähnlich wie er bei Haydns „Stabat Mater“, das zeitgleich entstanden ist, anzutreffen ist. Im Gegensatz zu immer wieder neuen Wendungen bei der Auslegung jedes Textdetails werden in dieser Messe erstmals größere Textabschnitte durch ein einziges Orchestermotiv zusammenfasst. Durch die überwiegende Verwendung des Dreiertaktes (3/4, 3/8, 6/8) entsteht ein pastoraler Grundton, der durch den rokokohaft verspielten Orgelpart noch verstärkt wird. Haydn beschränkt sich bei der solistischen Einbeziehung der Orgel nicht nur auf das Benedictus, sondern lässt die Orgel auch in den anderen Sätzen hervortreten.
Ein konkreter Anlass für die Komposition ist nicht bekannt. In seinem Entwurf-Katalog, den Haydn 1765 begonnen hat, ist die Messe als „Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae“ eingetragen, was die Bestimmung für ein marianisches Fest nahelegt. Da in Esterháza bzw. Eisenstadt kein Aufführungsmaterial aus der Entstehungszeit erhalten ist, könnte auch ein auswärtiger Auftrag möglich gewesen sein. Der Name „Große Orgelsolomesse“ stammt aus späterer Zeit als Unterscheidung zur Missa brevis Sti. Joannis de Deo, die den Beinamen „Kleine Orgelsolomesse“ erhielt. Zusätzlich zur originalen Instrumentierung sind in mehreren österreichischen und böhmischen Abschriften Stimmen für zwei Trompeten und Pauken überliefert. Die Orchesterbesetzung an das jeweils vorhandene Instrumentarium anzupassen war eine gängige Praxis.
(Text aus dem Internet, Autor unbekannt)
Als Solist*en wirken mit: Monika Riedler, Kathrin Auzinger, Gernot Heinrich, Klemens Sander
Zum Offertorium spielt das Orchester Mozarts Kirchensonate Nr. 10 in F, KV 244
Donnerstag, 29. Mai 2025, 10:30 Uhr – Christi Himmelfahrt
Ludwig van BEETHOVEN: Messe in C, op. 86
Verglichen mit etwa Wolfgang Amadeus Mozart oder Joseph Haydn schrieb Ludwig van Beethoven (1770-1827) nur wenig geistliche Musik: das Oratorium „Christus am Ölberge“ (1803), die Messe C-Dur (1807) und die alles überstrahlende große „Missa solemnis“ (1823).
Die Messe in C-Dur war ein Auftragswerk. Fürst Nikolaus II. Esterházy, in dessen Diensten Joseph Haydn ab 1795 wieder stand, bestellte sie bei Beethoven für den Namenstag seiner Frau im September 1807. Der Komponist war sich der Schwierigkeit der Aufgabe durchaus bewusst. Am 26.7.1807 schreibt Beethoven dem Fürsten, dass er „mit viel Furcht die Messe übergeben werde, da sie … gewohnt sind, die Unnachamlichen Meisterstücke des Großen Haidns sich vortragen zu lassen.“ Seine Sorgen waren nicht unberechtigt. Am 13.9.1807 fand in Eisenstadt die Uraufführung statt und der Auftraggeber war keineswegs zufrieden. „Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?“, bemerkte der Fürst. Das war noch harmlos ausgedrückt. In einem Brief an die Gräfin Henriette Zielinska wurde er deutlicher: „Beethovens Messe ist unerträglich lächerlich und hässlich, ich bin nicht davon überzeugt, dass man sie ernst nehmen kann.“
Beethovens sechssätzige Messe verstörte die Zeitgenossen. Neu war etwa der fast instrumentale Einsatz der Singstimmen. Beethoven bricht das tradierte Schema von geschlossenen Solopassagen und Chören auf und bettet stattdessen Chor und Solistenquartett in einer Art wechselseitigem Dialog die ganze Messe über in den Fluss der Musik. Dazu kommt, dass das Stück in unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner Oper „Fidelio“ und den berühmten Sinfonien Nr. 5 („Schicksalssinfonie“) und Nr. 6 („Pastorale“) entstand, deren atmosphärische Spuren auch in dieser Messe zu finden sind. Zwischen dem verhaltenen ersten Takten und dem friedlich ausklingenden Schluss entfaltet Beethoven seinen ungezügelten Gefühlskosmos und verknüpft die geistlichen Texte unüberhörbar mit seiner subjektiven, leidenschaftlichen Weltsicht. So erzählt die Messe C-Dur in nur knapp einer Stunde auch vom Grenzen sprengenden Freiheitskampf des Individuums, von rastloser Suche und von der tief empfundenen Sehnsucht nach einer besseren, menschlicheren Welt.
Heute präsentiert sich uns die Messe C-Dur nicht nur als ein im Ton durch und durch Beethoven‘sches Werk. Sie bietet überdies einen aufschlussreichen Blick in die Werkstatt des Komponisten und erweist sich so als eine Art „Pilotprojekt“, dessen Ergebnisse in der Symphonie Nr. 9 und der „Missa solemnis“ weiterentwickelt und zur Vollendung gebracht werden.
(Text aus dem Internet, Autor unbekannt)
Solistinnen und Solisten: Monika Riedler, Martina Steffl, Franz Gürtelschmid, Yasushi Hirano