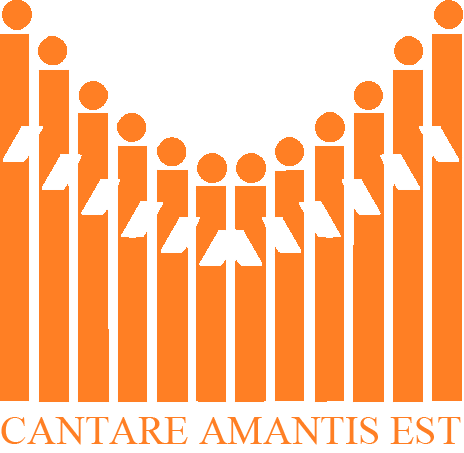Man kann Andreas Pixner eines wirklich nicht absprechen: Er hat eine gute Hand für Haydn! Das Konzert mit der „Schöpfung“ am 14. Mai war ein Ereignis, die Große Orgelsolomesse am 25. wunderbar musiziert und sehr schön gelungen! Bei der „Schöpfung“ hat uns zudem noch Gernot Heinrich „gerettet“, indem er kurzfristig für den indisponierten Daniel Johannsen eingesprungen ist. – Dafür schuldet Daniel uns etwas (und darüber weiter unten mehr). Cornelia Horak sang in bewährter Weise und glasklar in höchsten Höhen und Koloraturen, und eine echte Entdeckung (für uns) war Stefan Zenkl als Bass-Solist. Seine tiefen und tiefsten Töne fanden wohlverdientes Lob in höchsten Tönen: eine Idealbesetzung!
Mit dem Juni neigt sich das Arbeitsjahr der Chorvereinigung schon wieder dem Ende zu. So, wie auch die Oper im Sommer spielfrei hat, folgt auch unser Chor aus vielen Gründen dem Diktat der Schulferien. Davor aber stehen nach zwei Mozart-Messen am Fronleichnamstag Haydns wunderbare letzte Messvertonung, die Harmoniemesse, auf dem Programm, und am Sonntag darauf schließlich die geradezu bestürzend schöne, abgründige Es-Dur-Messe von Schubert. Und weil es wegen der Überlänge der Messe dann eh schon egal ist, singt uns Daniel Johannsen als kleine Entschädigung für seine Absage bei der „Schöpfung“ (s.o.) die ausladende, besetzungsmäßig aufwendige (und deshalb äußerst selten zu hörende) Motette „Intende Voci“ von Schubert, die man wegen der für sie erforderlichen Orchesterbesetzung zwingend mit der Es-Dur-Messe zusammen ansetzen muss.
Das Hochamt am 22. Juni wird daher nur wenig vor 12:30 zu Ende sein. Richten Sie sich bitte darauf ein und laufen Sie nicht gleich danach fort. Der Chor lädt nämlich wie schon letztes Jahr zum Saisonschluss alle Mitwirkenden und Mitfeiernden zu einer Agape und Begegnung auf dem Campus Akademie ein. Es darf ruhig auch einmal nach dem Hochamt noch gefeiert werden, was wir hier jeden Sonn- und Feiertag erleben dürfen. Pater Schörghofer hat es in der Predigt am 25. Mai auf den Punkt gebracht: in diesem „Experimentierfeld“ Jesuitenkirche stellen wir eine „Versuchsanordnung“ her, die ganz besondere Ereignisse ermöglicht, ganz besondere Erfahrungen eröffnet. Es entsteht eine Atmosphäre der Leichtigkeit, der Befreiung, der liebevollen Zuwendung, ja, des Schwebens. Wir verlassen die Kirche beglückt. Und dankbar. Das soll zum Abschluss der Saison noch einmal besonders zum Ausdruck kommen.
Es gibt Brot, Wein, Wasser, und was hilfreiche Hände sonst noch so mitbringen. Wie Gustav Schörghofer immer sagt: Herzlich eingeladen!
Martin Filzmaier
Sonntag, 1. Juni 2025, 10:30 Uhr:
W. A. MOZART: Missa brevis in D, KV 194
Die Missa brevis in D für Soli, Chor, Orchester und Orgel, KV 194 (186h), trägt in Mozarts Autograph den Datumvermerk: Salisburgo il 8 d‘ augusto 1774. Sie war wohl, wie auch die Missa brevis in F, KV 192 (186f), für den Salzburger Dom bestimmt. Als erste Messe W. A. Mozarts 1793 bei J. J. Lotter in Augsburg erschienen, bietet das Werk ein Beispiel größter Konzentration, wortreiche Abschnitte sind den Solisten zugeteilt. Die Motive sind von knappster Prägung. Vorspiele fehlen gänzlich, Gloria und Credo werden vom Priester intoniert. Auch tritt die kontrapunktische Verarbeitung merklich zurück, auf die Schlussfugen wird verzichtet. Auffallend ist die Neigung zu Molltonarten, auch in Passagen, die bei Mozart sonst stets in Dur erscheinen, wie „Quoniam“ und „Et in Spiritum Sanctum“. Bemerkenswert auch, dass Mozart im „Incarnatus“ des Solo-Soprans das „homo factus est“ vom Solo-Bass singen lässt, die Menschwerdung im Gegensatz zu „de Spiritu Sancto ex Maria virgine“ also dem tiefen männlichen Register zuteilt. Die Besetzung der Missa brevis in D beschränkt sich auf Violinen, Bassi und Posaunen. Wie aus dem Aufführungsmaterial des Salzburger Domchores hervorgeht, gehörten innerhalb des traditionellen „Kirchentrios“ – zwei Violinen und Bassi – zur Gruppe der Fundamentalstimme: Orgel, Violone (Kontrabass) sowie als verstärkendes 8-Fuß-Instrument ein Fagott. Die Mitwirkung des Violoncellos wurde erst in späterer Zeit – ab der Krönungsmesse KV 317 – zur Selbstverständlichkeit. Die Bezeichnungen „Soli“ und „Tutti“ in der Orgelstimme weisen auf die damals im Salzburger Dom praktizierte Begleitung mit zwei verschiedenen Orgeln hin.
(Text aus dem Internet, Autor unbekannt)
Als Solisten wirken mit: Ursula Langmayr, Gernot Heinrich und Markus Volpert.
Zum Offertorium erklingt die Kirchensonate in G, KV 274.
Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, 10:30 Uhr:
W.A.MOZART: Orgelsolomesse, KV 259
Die beiden C-Dur-Messen KV 258 und 259 sind zwischen Ende 1775 und 1776 entstanden. Sie weisen einige Parallelen auf. Der durch Pauken und Trompeten entstandene feierliche Charakter der beiden Messen wird durch später hinzugefügte Oboen-Stimmen weiter hervorgehoben. Dem Gebot der Kürze – eine ausdrückliche Anordnung des Salzburger Fürsterzbischofs – kommt große Beachtung zu. Es finden sich formale und satztechnische Neuerungen in den Sätzen Benedictus und Agnus Dei.
Die Orgelsolo-Messe KV 259 ist die kürzeste Messe Mozarts. Im Credo führt die Kürze zu diffuser Polytextur. Die konzertierende Behandlung der Orgel im Benedictus gab dieser Messe ihren Beinamen. In der Regel ist die Orgel in der figuralen, d.h. in der mit mehrstimmigem Gesang und Orchester bestrittenen Kirchenmusik ja nur begleitendes Continuo-Instrument. Seit der Frühklassik bis ins frühe 19.Jahrhundert wurde sie aber fallweise auch solistisch eingesetzt. Von Mozart in dieser Messe und in der „Missa solemnis“ KV 337, aber auch in der ersten seiner Vespern (KV 321).
des Benedictus ist in dieser Messe dem Soloquartett anvertraut, das sich zu einer ausgeschriebenen Kadenz über einem Orgelpunkt auf dem D des Orgelpedals steigert, wie sie in vergleichbarerer Weise aus Ensembles in Mozarts spätem Opernschaffen bekannt ist. Der liebliche Beginn des Kyrie hat eine solche Entwicklung und Steigerung gar nicht ahnen lassen.
Der erste Teil des Agnus Dei wirkt mit seiner pizzicato begleiteten Violinmelodie wie eine Serenade.
Einen Einblick in die kirchenmusikalische Praxis, aber auch in die stete Notwendigkeit, eine Kongruenz zwischen dem liturgischen Rang eines Festes und der dabei erklingenden Kirchenmusik herzustellen, liefert uns ein Brief Leopold Mozarts vom 28.Mai 1778 an seine Frau und an seinen Sohn in Paris. Am 17.Mai hatte im Salzburger Dom eine Bischofsweihe stattgefunden, bei der Leopold Mozart die Kirchenmusik zu leiten hatte: „Ich machte des Wolfg: Messe mit dem Orgl Solo: das Kyrie aber aus der Spaur Messe.“ Das schlichte Kyrie der „Orgelsolomesse“ war dem Fest der Bischofsweihe nicht adäquat, daher wurde es einfach aus der (heute so genannten) „Credomesse“ ersetzt.
Es musizieren mit uns Monika Riedler, Mari Nakayima, Stephen Chaundy und Klemens Sander.
Es dirigiert Guido Mancusi.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Veni Sancte Spiritus“ KV 47 von Mozart.
In seinem Verzeichnis der Jugendwerke seines Sohnes hat Leopold Mozart ein Veni Sancte Spiritus eingetragen, zu dem seine Tochter Maria Anna (Nannerl) die Jahreszahl 1768 gesetzt hat. Das Autograph ist nicht überliefert. Nähere Umstände zur Entstehung kennen wir nicht. Der Text folgt nicht der Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ (Komm heiliger Geist), sondern der mit eben diesen Worten beginnenden Antiphon der Votivmesse zu Ehren des Heiligen Geistes. Daher muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Komposition zum Pfingstfest des Jahres 1768 in Wien entstanden ist, wo sich die Familie Mozart damals aufgehalten hat.
Der weitgehend homophone Duktus dieses Werkes, ein Unisono-Beginn in C-Dur-Dreiklängen und das in einem eigenen Presto-Satz groß angelegte Alleluja entsprechen nicht einer üblichen Heilig-Geist-Messe, sondern einem außerordentlichen Festcharakter. Die zweiteilige Anlage mit einem Allegro im Zweiviertel- und einem Presto im Dreivierteltakt ist um diese Zeit in vielen chorischen Motetten der Wiener Kirchenmusikszene zu finden. Mozart hat sich damit ganz in die Erwartungshaltung der hiesigen kirchenmusikalischen Praxis eingeordnet. Er wollte damit offensichtlich – ganz der Regie des Vaters entsprechend – nicht mit Ungewohntem überraschen, sondern seine Meisterschaft darin zeigen, dass er sich der 12-jährige Komponist mit jedem anderen messen konnte.
(Text aus“ Mozart Sakral“, dem Begleitbuch zur Mozartjahr 2006)
Donnerstag, 19. Juni 2025, 10:30 Uhr: Fronleichnam
Joseph HAYDN: „Harmoniemesse“, Messe in B-Dur, Hob.XXII:14
Die Harmoniemesse (1802) ist gelegentlich als „die schönste Messe neben Beethovens Missa solemnis“ bezeichnet worden. Haydn schrieb sie als 70-Jähriger auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Sie entstand nach den beiden Alterswerken „Die Schöpfung“ (1799) und „Die Jahreszeiten“ (1802). Noch überzeugender als in früheren Messvertonungen glückte Haydn in der Harmoniemesse eine kunstvolle Verbindung von symphonischem und oratorischem Stil.
Joseph Haydn war eine hochangesehene Persönlichkeit, als er 1790 nach dem Tod des Fürsten Nicolaus I. von Esterházy nach fast 30-jähriger Tätigkeit aus dem Kapellmeisterdienst entlassen wurde. Materiell unabhängig, übersiedelte Haydn von Eisenstadt nach Wien, um sich als freier Künstler ganz seinem Schaffen zu widmen. Zwei längere Aufenthalte in England brachten ihm große Erfolge, u.a. mit den 12 Londoner Symphonien. 1791 wurde Haydn mit der Doktorwürde der Universität Oxford geehrt. Als 1795 die Esterházysche Kapelle unter dem neuen Fürsten Nicolaus II. ihren Dienst wieder aufnahm, berief man Haydn erneut zum Kapellmeister. Seine Anwesenheitspflicht in Eisenstadt beschränkte sich aber nunmehr auf die Sommer- und Herbstzeit, außerdem hatte er alljährlich zum Namenstag der Fürstin Esterházy eine Messe zu schreiben. Dieser Vereinbarung verdanken wir die Entstehung der sechs späten Messen, der Paukenmesse (1796), Heiligmesse (1796), Nelsonmesse (1798), Theresienmesse (1799), Schöpfungsmesse (1801) und schließlich der Harmoniemesse.
Am 14. Juni 1802 informierte Haydn den Fürsten, dass er an der für den Namenstag des Jahres 1802 bestimmten „Neuen Meß sehr mühesam fleißig“ sei. Tatsächlich hat der Komponist an diesem Werk mit besonderer Sorgfalt gearbeitet. Gegenüber einigen früheren Messen Haydns zeichnet es sich durch Vollständigkeit und korrekte Abfolge des liturgischen Textes aus. Keine andere kirchliche Komposition Haydns ist so glänzend instrumentiert wie diese; die als außergewöhnlich reich empfundene Bläserbesetzung brachte dem Werk später den Beinamen „Harmoniemesse“ ein, der aber auch unter den Eisenstädter Orchestermitgliedern dazu gedient haben mag, diese Messe von ihren beiden ebenfalls in B-Dur stehenden Vorgängerinnen zu unterscheiden. Auch der ersten Aufführung der Messe hat Haydn große Aufmerksamkeit gewidmet. Schon im erwähnten Brief an Esterházy gestand er, „forchtsam“ zu sein, „ob ich noch einigen beyfall werde erhalten können„. Die auffallend große Zahl von Änderungen, die der Komponist persönlich in die von seinem Kopisten ausgeschriebenen Stimmen eingezeichnet hat, lässt darauf schließen, dass die Einstudierung des Werkes mit großer Akribie erfolgt ist. Bei ihrer Uraufführung am 8. September 1802 in der Bergkirche zu Eisenstadt wurde die Harmoniemesse begeistert aufgenommen. Der Londoner Gesandte Ludwig Fürst Starhemberg, einer der zahlreichen adeligen Festteilnehmer, sah in der Aufführung unter Leitung des 70-jährigen Haydn ein kaum zu überbietendes Kunstereignis („Riens de plus beau et de mieux exécuté„). In seinem Tagebuch rühmt er die „Messe superbe, nouvelle musique excellente du fameux Haydn„.
Stilistisch vereinen sich in Haydns späten Messen Traditionen der alt-österreichischen Barockmusik, von denen die Jugendzeit des Komponisten geprägt war, mit seinem symphonischen Spätstil. Von ihnen führt ein direkter Weg zu den beiden Oratorien Die Schöpfung (1799) und Die Jahreszeiten (1801). Die Harmoniemesse, ist Haydns letzte vollendete Messkomposition, nicht nur in chronologischer, sondern auch in künstlerischer Hinsicht. Mit Recht kann man, wie Leopold Nowak formulierte, in der Harmoniemesse „eine Art ‚Summa Missarum Josephi Haydn'“ sehen. Dass der Messe dennoch bis heute nicht die ihr gebührende Wertschätzung entgegengebracht wird, ist wohl vor allem auf den Einfluss des Cäcilianismus im 19. Jahrhundert zurückzuführen, von dem die Kirchenmusik etwa der Wiener Klassik als unkirchlich angesehen und daher abgelehnt wurde.
Solistinnen und Solisten: Cornelia Horak, Martina Steffl, Alexander Kaimbacher und Yasushi Hirano.
Zum Offertorium sing der Chor das Graduale zum Fronleichnamsfest „Ave verum“ von Mozart.
Ave verum sind die Anfangsworte eines spätmittelalterlichen Reimgebets in lateinischer Sprache. Es entstand wahrscheinlich im 13. Jahrhundert; der Verfasser ist unbekannt. Der Text hat seinen Sitz im Leben in der Eucharistieverehrung. Die Gläubigen grüßen den wahren Leib des Erlösers in der Brotgestalt des Sakraments und verehren das Erlösungsleiden Christi. Das Gebet mündet in die Bitte um den Empfang der Kommunion in der Todesstunde als Vorgeschmack des Himmels.
Ave verum corpus, natum de Maria virgine, vere passum immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine: Esto nobis praegustatum in mortis examine.
„Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von Maria, der Jungfrau, der wahrhaft litt und geopfert wurde am Kreuz für den Menschen; dessen durchbohrte Seite von Wasser floss und Blut: Sei uns Vorgeschmack in der Prüfung des Todes!“
Die heute bekannteste und am häufigsten aufgeführte Vertonung ist die von Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Fassung gab der alten Sequenz weite Verbreitung auch außerhalb kirchlicher Anlässe. Der Text betrachtet entsprechend der christlichen Glaubenslehre die leibliche Gegenwart des Heilands in der Eucharistie. Die letzten Zeilen verweisen auf das Vorbild des sterbenden Erlösers für seine gläubigen Nachfolger. Das wissen zwar nur noch wenige; trotzdem wählen Hinterbliebene als musikalische Begleitung für Trauerfeiern oft diese besinnliche, spannende und zuletzt tröstliche Musik Mozarts.
Mozart komponierte die 46 Takte für Chor, Streicher und Orgel (KV 618) knapp ein halbes Jahr vor seinem Tod, während er zugleich an der Zauberflöte und dem Requiem arbeitete. Das Autograph ist auf den 17. Juni 1791 datiert. Die Komposition war für das Fronleichnamsfest in Baden bei Wien, wo Mozarts Frau Constanze sich im neunten Ehejahr auf ihre sechste Niederkunft vorbereitete, bestimmt. Sie wohnte bei Anton Stoll, dem Chorleiter des Badener Kirchenchors, der die Motette dafür als Geschenk annahm.
Hector Berlioz nannte das Werk als Vorbild für richtige Verwendung der menschlichen Stimme: „Zu einem Andante [für Chorstimmen] in gehaltenen und sanften Tönen wird [der Tonsetzer] nur die Töne der Mittellage verwenden, da diese allein die geeignete Klangfarbe haben, mit Ruhe und Reinheit angegeben und ohne die geringste Anstrengung pianissimo ausgehalten zu werden. So hat es auch Mozart in seinem himmlischen Gebet ‚Ave verum corpus‘ getan.“
CD-Tipp: Diese Motette von Mozart finden Sie auf der CD „Mozart Krönungsmesse + Missa solemnis“
Sonntag, 22. Juni 2025:
Franz SCHUBERT (1797-1828): Messe Nr. 6 in Es-Dur, D 950 (1828)
Von den insgesamt sechs lateinischen Messen Franz Schuberts entstanden die ersten vier in den Jahren 1814 bis 1816; sie sind als Jugendwerke anzusehen und legen bereits Zeugnis einer überquellenden Frühbegabung ab. Überdies berühren und beeindrucken sie durch eine innige Melodik und eine souveräne Beherrschung der traditionellen Messform. Schuberts Lehrer Michael Holzer (1772-1826), Organist und Regens chori der heimatlichen Liechtentaler Pfarrkirche, war es, der vermutlich als erster das aufscheinende Genie an dem kaum Zehnjährigen erkannte. Wie Schuberts Bruder Ferdinand (1794-1859) überliefert, soll Holzer mit Tränen in den Augen versichert haben, ein Schüler wie Franz sei ihm nie zuvor untergekommen: „wenn ich ihm was Neues beibringen wollte, da wusste er es immer schon; oft habe ich ihn stillschweigend angestaunt.“
Ungleich gewichtiger durch Größe und Weite ihrer Disposition erweisen sich die Messen Nr.5 in As-Dur (1819-1822) und Nr.6 in Es-Dur aus dem Todesjahr 1828. Beide sind von liedhaftem Melos erfüllt und Ausdruck einer ernsthaften, individuellen Auseinandersetzung mit dem liturgischen Text.
Schubert begann mit der Komposition seiner letzten Messe im Juni 1828. Eine Anregung zu diesem Werk mag von der Kirchengemeinde der Wiener Alser-Vorstadt ausgegangen sein, an der im Jahr zuvor ein neuer, noch in der Aufbauphase befindlicher Verein zur Pflege der Kirchenmusik gegründet worden war. Von der mit Eifer angegangenen Arbeit zeugt eine Briefäußerung von Schuberts Förderer Johann Baptist Jenger, der am 4. Juli 1828 aus Wien über den Komponisten schrieb: „Er ist dermalen noch hier, arbeitet fleißig an einer neuen Messe, und erwartet nur noch – wo es immer herkommen mag – das nötige Geld, um sodann nach Ober-Österreich auszufliegen.“
Wie zahlreiche eigene Werke, hat Schubert auch seine Messe Es-Dur niemals öffentlich hören können. Ihre Uraufführung in der Alserkirche zur heiligen Dreifaltigkeit fand erst am 4. Oktober 1829, ein knappes Jahr nach dem Tod des Komponisten, unter der Leitung Ferdinand Schuberts statt. Mit der Aufführung der Messe wurde zugleich das inzwischen zweijährige Bestehen des genannten Vereines würdig begangen. Die umfangreiche, in der Wiener allgemeinen Theaterzeitung vom 22. Oktober 1829 erschienene Rezension lässt etwas von der Ergriffenheit spüren, die das erhabene Werk offenkundig schon beim ersten Erklingen auslöste: „Zur größeren Verherrlichung dieser Feyer wurde eine, von dem allgemein betrauerten, für die Kunst viel zu früh verblichenen Tondichter Franz Schubert, große Messe aufgeführt. Sie ist seine letzte und größte, und, wie viele Kenner behaupten, auch seine schönste, nach deren Beendigung fast unmittelbar ihn der unerbittliche Tod allzufrüh ereilte. Mit Recht muß man das ganze Werk wahrhaft großartig nennen, und die Verbreitung desselben und jedem wahren Freunde erhebender Kirchenmusik, und allen Verehrern des unvergeßlichen Komponisten dringend an’s Herz legen. Aber so schön es ist, eben so schwierig ist seine Aufführung. Jedes einzelne Instrument ist mit schweren Stellen, vorzüglich in den figurirten Stellen bedacht, ganz besonders aber haben hier die Singparten eine schwere Aufgabe zu lösen. Ungeachtet dessen wurde die Messe bey einer sehr zweckmäßigen Besetzung exkutirt.“
Des Weiteren bekundete der anonyme Rezensent, in dem Werk herrsche „ein ganz eigener Karakter“ – eine Beobachtung, die wohl auf die neue, mit tiefer Empfindung durchlebte musikalische Auslegung des lateinischen Textes zu beziehen ist. Auch der sinfonische Kompositionsstil, der sich bereits in der As-Dur-Messe ankündigte, tritt hier noch stärker hervor. Die Besetzung ist die damals übliche, hier allerdings mit fünf Solisten (Sopran, Alt, zwei Tenöre, Bass) und einem Orchester ohne Flöten. Das erstmalige Fehlen einer Orgelstimme ist in der Funktionsverlagerung von der liturgischen Bestimmung der frühen Messen hin zur Konzertmesse begründet. Allein die Spieldauer von knapp einer Stunde würde den Rahmen eines Gottesdienstes sprengen.
Die Tatsache, dass Schubert den Wortlaut des „Ordinarium missae“ in keiner seiner sechs Messen vollständig übernommen hat, ist immer wieder kontrovers diskutiert worden. Seine Textmodifikationen sind von Werk zu Werk unterschiedlich, lediglich die letzten beiden Messen sind im Wortlaut nahezu identisch, doch gibt es auch hier Abweichungen von der liturgischen Vorlage. Hauptsächlich die Auslassung im Credo „Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ (Und [ich glaube] an die eine heilige katholische und apostolische Kirche) musste sich kritische Deutungsversuche gefallen lassen; ihr Spektrum reicht von unterstellter ‚Protesthaltung‘ über ‚mangelnde Lateinkenntnisse‘ bis hin zu ‚vorübergehender Zerstreutheit‘. Schuberts Eliminierung gerade dieser Textpassage war jedoch keine Frage der Religiosität, sondern ist als Ablehnung der dogmatischen Glaubenslehre zu verstehen.
Die formale Gliederung der sechsteiligen Komposition ist von großer Klarheit. Schubert greift auf tradierte Satzstrukturen zurück, verleiht aber auch ihnen eine ‚ganz eigenen Charakter‘:
Im Kyrie ist die traditionelle Dreiteiligkeit durch einen vierten Teil erweitert, der motivisch Teil drei fortsetzt. Die achttaktige Coda beendet den Satz über einem Orgelpunkt auf Es.
Den umfangreichen Text des Gloria gliedert Schubert kompositorisch in zwei schnellere Außenteile, einen ruhigeren Mittelteil und die monumentale Schlussfuge „Cum Sancto Spiritu“.
Ebenfalls vierteilig ist die weiträumige Anlage des Credo. Zwei mit Moderato überschriebene Außenteile umschließen einen Andante-Mittelteil. Auch diesen Satz krönt Schubert konventionell mit der groß angelegten Fuge „Et vitam venturi“.
Die zweimal durchgeführten Sanctus-Anrufungen sind durch eine moderne, zukunftsweisende Harmonik geprägt, dabei löst die im Bass abwärts schreitende Ganztonskala über eine Oktave Verwunderung aus. Der Satz mündet in das „Osanna“, ein lebhaftes Fugato.
Im Benedictus stehen sich zwei Themenkomplexe gegenüber. Eine kurze neuntaktige Überleitung führt zur Reprise, ihr folgt die notengetreue Wiederholung des „Osanna“ aus dem Sanctus.
Das abschließende Agnus Dei beginnt mit einer Exposition, der zwei Wiederholungen des „Agnus Dei“ jeweils im Wechsel mit den Zwischenspielen „miserere nobis“ folgen. Zweiteilig angelegt ist das „dona nobis pacem“. Dieses wird durch ein viertes, leicht modifiziertes „Agnus Dei“ erweitert, ehe das wiederkehrende „dona nobis pacem“ den Satz in die erlösende Stille des „Kyrie“ zurückführt.
Am 6. Jänner 1839 schrieb Robert Schumann an den Verlag Breitkopf&Härtel nach Leipzig: „Ich war vor einigen Tagen bei dem Bruder von Franz Schubert und sah mit Verwunderung die Schätze, die in seinem Verwahr sind. Es sind einige Opern, vier große Messen, vier bis fünf Sinfonien und vieles andere. Namentlich erlaube ich mir, Sie auf die höchst merkwürdigen Messen und Sinfonien aufmerksam zu machen“. Unter den erwähnten vier großen Messen befand sich auch die Es-Dur-Messe. Ferdinand Schubert verkaufte es 1843/44 (zusammen mit weiteren Manuskripten) an den Direktor des Konservatoriums in Rom, Ludwig Landsberg. Nach dessen Tod ging die Handschrift 1862 an die Musiksammlung der Königlichen Bibliothek in Berlin über (heute Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz), wo sie seither aufbewahrt wird.
Auf Initiative von Johannes Brahms erschein 1865 der Erstdruck in Partitur und Stimmen im Verlag Jakob Rieter-Biedermann in Leipzig.
(Text: Rüdiger Bornhöft aus dem Vorwort des Klavierauszuges der Edition Peters 2009)
Solistinnen und Solisten: Monika Riedler (Sopran), Martina Steffl (Alt), Daniel Johannsen (Tenor I), Lorenz Höbarth (Tenor II) und Yasushi Hirano (Bass).
Zum Offertorium präsentieren wir Schuberts späte Motette für Chor und Tenorsolo „Intende voci“, D 963. Schubert schrieb das Stück im Oktober 1828 als „Aria con Coro“ zusammen mit einem „Tantum ergo“. Vermutlich handelt es sich um eine der letzten Kompositionen des Meisters, wenn nicht gar um die letzte. Der äußere Anlass ist auch hier unbekannt, stehen Umfang und Besetzungsaufwand doch im seltsamen Missverhältnis zur liturgischen Ortung des Textes, der zur Messe des Freitags nach dem 3.Fastensonntag gehörte, also einem gewöhnlichen Werktag in einer Zeit des Kirchenjahres, da Instrumentalmusik aus der Liturgie verbannt war. Das großartige, festfreudige Stück lässt den Meister der Es-Dur-Messe erkennen. Nach einem Orchestervorspiel, in welchem die 0boe die führende Rolle spielt, setzt der Solotenor in ariosem Überschwang ein, mit dem später einfallenden Chor ständig dialogisierend. Das Ganze trägt mehr festlichen als dem Text entsprechenden flehenden Charakter. Das mit 10 Minuten Dauer den liturgischen Rahmen eines Offertoriums sprengende, reife und künstlerisch bedeutende Werk ist sicherlich eine absolute Rarität und nur bei uns zu hören!
Text: Alfred Beaujean im Booklet der CD von Capriccio 10 244 (1988).
CD-Tipp: Diese Motette finden Sie auf der CD „Schubert Messe in G“, ebenfalls gesungen von Daniel Johannsen!