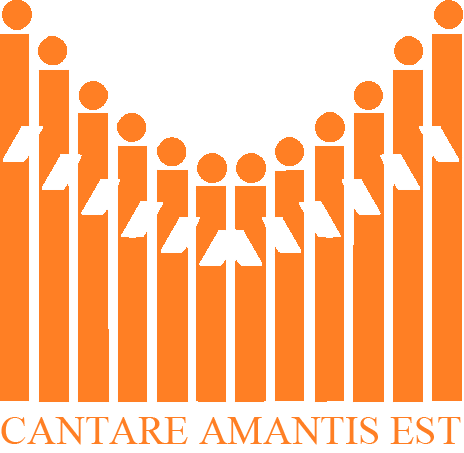Man muss ja zugeben, dass diese Messe – mehr noch als andere Werke vergleichbarer Dimension – etwas tut, was Kirchenmusik eigentlich nicht sollte: sich gegenüber der Messliturgie in den Vordergrund stellen. Während auch die Chorvereinigung sich traditionell als eine Dienerin, Unterstützerin der Liturgie versteht, und eben nicht als Konzertchor, der im Rahmen der Liturgie seinen Auftritt hat, lässt die f-Moll-Messe eine solche Rolle beinahe nicht mehr zu. Zu gewaltig sind ihre inhaltlichen Dimensionen – und dabei ist nicht einmal die Länge des Werkes gemeint. Sie zieht die Ausdeutung des Mysteriums der Messfeier auf eine Weise an sich, welche die dienende Funktion der Musik überhöht und auflöst. Sie selbst ist es, die Vorsteher (Priester) und Mitfeiernde in einer Weise mit den Inhalten der Texte konfrontiert, dass ein „normaler“, routinemäßiger Ablauf der Liturgie unmöglich wird. Sie ist theologische Programmmusik auf höchstem Niveau, ist Evangelium, Bekenntnis und Verkündigung. In jeden einzelnen Takt hat Bruckner an den dichtesten Stellen der Komposition theologische Ausdeutung und Symbolik gelegt. – Ein wenig davon versuche ich weiter hinten in diesem Kommentar auszuführen.
Zur Werkgeschichte
Der damals noch (aus Wiener Sicht) in der Provinz, in Linz, ansässige Bruckner wurde 1867 nach dem Erfolg seiner d-Moll-Messe vom Obersthofmeisteramt beauftragt, eine Messe für die Hofmusikkapelle zu schreiben. Das Werk wurde von den Musikern jedoch prompt als unspielbar abgelehnt und somit zunächst „schubladisiert“. Bruckner wollte sich damit nicht zufriedengeben, mietete kurzerhand um 300 Gulden das Hofopernorchester und engagierte den Singverein, um das Werk fast 5 Jahre nach seiner Entstehung doch noch aufführen zu können. Dies geschah schließlich mit großem Erfolg, nach vielen Widerständen und mühsamer Probenarbeit, am 16. Juni 1872 in St. Augustin, bemüht dirigiert von Bruckner selbst, nachdem der Chef des Singvereins, Johann v. Herbeck, im letzten Moment die Nerven und das Dirigat geschmissen hatte.
Die Messe wurde dann von Bruckner immer wieder ein wenig nachbearbeitet, auch noch öfter unter seiner Leitung aufgeführt, blieb jedoch auf Grund ihrer außerordentlichen Anforderungen an Chor und Orchester für den „normalen“ Kirchenmusikbetrieb unspielbar und jenen wenigen Orten vorbehalten, welche die besten Sänger und Orchestermusiker zur Verfügung hatten.
Zum Inhalt der einzelnen Sätze
Eigentlich erübrigt sich ein Kommentar zum Inhalt eines gleichbleibenden, immer neu vertonten Textes. Bei Bruckner allerdings geht es nicht bloß darum, wie der katholische Messtext neu vertont wurde; er kleidet den Text musikalisch aus und bringt – wie z. B. im Credo – Glaubenswahrheiten zwischen die knappen Textzeilen, die an der jeweiligen Stelle gar nicht ausgesprochen, wohl aber mitgemeint sind. Oder er entwirft einen himmlischen, entrückten Klangraum – wie im Sanctus -, den der Text zwar als Deutung nahelegt, der aber von anderen Komponisten seit dem 15., 16. Jahrhundert so nicht mehr eröffnet wurde.
Die folgende Werkbesprechung soll ein wenig Einblick in die faszinierende Klang(ver)dichtung Bruckners und seinen gar nicht so (wie oft unterstellt wird) „einfältigen“ oder naiven Glauben geben, die sich den meisten Zuhörern beim einmaligen „Durchlauf“ des Werkes leider kaum erschließen, weil sie – wir – normalerweise nicht gewohnt sind, so viel verdichtete Information aufzunehmen. Einstudierung und Proben der Messe gibt den Chormitgliedern die Möglichkeit, tiefer in die Feinheiten der Komposition einzudringen; so auch dem oftmaligen Hörer. Und auch wer bisher nichts mit Begriffen wie Chromatik und Tonartencharakteristik anfangen konnte, mag eine Idee davon bekommen, wie der Komponist hier ganz bewusst die verschiedenen Tonarten einsetzt und damit ein Klangbild entwirft, wie auch ein Maler einmal kräftige, helle oder dunkle Farbtöne, und dann wieder nur feinste Nuancen verwendet, um Wirkung und Stimmung zu erzeugen, um eine Geschichte zu erzählen. Zudem stehen in der traditionellen Lehre der Chromatik jede Tonart nicht nur für eine bestimmte (Klang)farbe, sondern wird auch mit bestimmten Inhalten assoziiert (z. B. g-Moll: „Tod“; D-Dur: „Sieg“, usf.). Diese Deutungen sind freilich umstritten; doch ist es nicht so wichtig, ob man daran „glaubt“. Entscheidend ist, dass die Komponisten in dieser Tradition ihr Handwerk erlernt haben und, wie sich immer wieder zeigt, bestimmte Tonarten (bewusst?) als Codes für bestimmte Inhalte einsetzen. So ist etwa in der f-Moll-Messe praktisch immer, wenn Des-Dur verwendet wird, direkt von Gott oder seinem Wirken die Rede. In diesem Sinne einer Entschlüsselung, Decodierung der Musik sind meine zahlreichen Hinweise auf die jeweils verwendeten Tonarten zu verstehen.
Kyrie
Das Kyrie beginnt verhalten in dunklem f-Moll, die Kyrie-Rufe des Chores sind, in ihren absteigenden Linien, mehr Bitten als Anrufungen. Das Christe setzt in Es-Dur fort und steigert, von der Solovioline begleitet, kontinuierlich durch verschiedene Dur-Tonarten hindurch in ein strahlendes B-Dur – aber nur für den ersten Ton der Silbe „Chri-„; denn schon beim „-ste“ ist die Tonart durch Verminderungen und Hebungen in den Stimmlinien nicht mehr klar erkennbar. Wir sind bei diesem Ruf nach Christus musikalisch auf sehr unsicherem Boden, wie der zweifelnde Petrus, dem es nicht gelingt, wie sein Herr auf dem Wasser zu wandeln, der unterzugehen droht und nach Jesus um Hilfe ruft. Die „Christe“-Rufe fallen rasch ins Piano und nach d-Moll zurück, werden von den Solisten aufgegriffen und münden schließlich in die erste verlässliche, tragfähige Tonart, Ges-Dur. Der Höhepunkt des Satzes ist kaum erreicht, verklingen die Rufe nach nur 6 Takten auch schon wieder, und die Musik fällt in das verhaltene f-Moll des Anfangs zurück: die Reprise „Kyrie“. Die Entwicklung verläuft jedoch anders als beim ersten, fast zaghaften Kyrie-Ruf. Der Chor steigert aus dem düsteren f-Moll (4 vermindernde Vorzeichen) die Rufe bald zum anderen Ende der chromatischen Skala, in ein strahlendes E-Dur (4 erhöhende Vorzeichen) im Fortissimo. Wie so oft bei Bruckner wird an diesem kurzen Höhepunkt abgebrochen. Die Musik moduliert nun über 12 Takte zu einem neuen Ansatz: Kyrie-Rufe in f-Moll, wie gehabt? Nein: f-Moll diesmal lediglich mit einem einzigen Intervall, der Quart, wie ein Aufblicken nach oben; die Musik drängt vorwärts, und nach 4 Takten: eine Tonspaltung! F wird zu gleichzeitigem F und Ges, notiert als kleine Sekund, eigentlich aber eine übermäßige Prim – frühes Beispiel für Bruckners später (z. B. am Beginn der 9. Symphonie) wiederverwendetes Stilmittel, einen Ton dissonant zu spalten (die Sekund, zumal die kleine, ist traditionell die größtmögliche Dissonanz zweier Töne) und daraus eine neue harmonische Entwicklung zu beginnen. Nach 4 Takten musikalischer Ungewissheit folgt, analog zum „Christe“-Teil, die zweite tragfähige Tonart dieses Satzes, das „exotische“ Ces-Dur (7 vermindernde Vorzeichen): ein kurzer Jubel, fortissimo, von nur 8 Takten, dann subito pianissimo: das 4x pochende, unbegleitete Ces der Bässe ist nun, enharmonisch verwechselt (gleicher Ton, anders notiert – also nicht „derselbe“), ein H, somit Leitton der „Erlösungstonart“ C-Dur, wo der Chor a cappella hingelangt, jedoch nur für einen Takt: ohne Modulation geht der Chor, immer noch unbegleitet, in das musikalisch sehr weit entfernte Ges-Dur und setzt von dort zum letzten Kyrie-Ruf in f-Moll an. Der Satz verklingt im Pianissimo, nachdem der Chor unisono auf der Dominante, dem C, endet: die Musik schließt nicht ab, der Chor lässt sie offen, hörend auf die Antwort des Herrn.
Gloria
Im Jubel des Gloria, fast ist man geneigt zu sagen, „natürlich“, in C-Dur, spannt Bruckner die Musik weit aus. Große Intervall- (meist Oktav-)sprünge innerhalb der Stimmgruppen, lange Liegetöne, oft unterlegt von raschen Unisono-Abwärtsbewegungen des Orchesters. So auch bei der Textstelle „pater omnipotens“, wo der gesamte Chor das „o“ von „omnipotens“ über 10 Viertelschläge hinweg hält – eine musikalisch kaum endenwollende Allmacht.
Das „Qui tollis“ schließt in d-Moll an, ein langsamer, inniger Teil des Gloria, mit den flehenden „miserere“- und „suscipe“-Bitten. „Der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt“ beginnt in nüchternem d-Moll, der musikalische Bogen crescendiert – und bricht plötzlich, überraschend und subito pianissimo, an der Mittelsilbe von „peccata“ ab, bzw. wird über Ges-Dur in ein tröstliches Des-Dur („Tonart des Göttlichen“) übergeführt. Eigentlich logisch, wenn wir glauben, was der Text hier sagt: die Sünden der Welt mögen wohl eine schlimme Sache sein, doch werden sie vom Erlöser weggenommen, aufgelöst in eine ferne Dur-Tonart. Und schließlich „Qui sedes“, „der Du sitzt zur Rechten des Vaters“: dieser Ort steht in glücklichem, hellem A-Dur, fern vom d-Moll unserer irdischen Lasten.
„Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris“: die endlose Weite der Herrlichkeit Gottes, des Vaters, angezeigt durch einen Unisono-Liegeton auf die Silbe „glo-„, den der Chor über 5 Takte hinweg unverändert hält. In das anschließende Schweigen des Orchesters leitet der Chor nun die Gloria-Fuge ein. Mit diesem kontrapunktischen Meisterwerk aus einem bemerkenswerten Fugenthema, das mit großen, ungewöhnlichen Intervallsprüngen beginnt, schließt der Gloria-Satz im „Amen“-Jubel ab.
Credo
Im flotten alla-breve C-Dur beginnt das Credo zunächst recht konventionell und demonstriert etwas, das man in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts noch unangefochten haben konnte: die Freude am Glauben. Das läuft so bis zum „Schöpfer des Himmels und der Erde“ und der Chor erläutert im Piano „visibilium omnium“ und – noch eine Stufe leiser, einen Halbton nach unten gerückt, wie ein Geheimnis, „et invisibilium“, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge also. Ähnlich kurz darauf wieder das Konstrukt „Deklaration – Glaubensgeheimnis“: „Et in unum Dominum Jesum Christum“ ist das Glaubenszeugnis, vorgetragen im C-Dur-Fortissimo, gefolgt vom tieferen Glaubensgeheimnis „et ex patre nato“, das sich bei „ante omnia saecula“, „vor aller Zeit“, in der Pianissimo-Tiefe grauer Vorzeiten verliert. Die 3 Aussagen über das Wesen Christi folgen nun in neuen Tonarten, eine breite Farbskala tut sich auf. Zunächst As-Dur: „Deum de Deo“, deklamiert der Chor, die Solisten folgen als Echo; ebenso, aber im reinen Licht von C-Dur, das „lumen de lumine“, und als Höhepunkt nun das „Deum verum de Deo vero“, 8 Takte in zutiefst überzeugter – und überzeugender – Des-Dur-Harmonie („Tonart des Göttlichen“ – s. o.). Und wieder die „Weite bei Anton Bruckner“ (vgl. den Beitrag von Leopold Nowak in der Festschrift zur 900-Jahr-Feier von St. Florian): im „per quem omnia facta sunt“ („durch den alles geworden ist“) zieht sich, wie im Gloria, das „o-“ im Chor schier endlos über mehrere Takte. Nächstes Bekenntnis, wieder C-Dur, Fortissimo: „Qui propter nos, nos homines“. Hier erlaubt Bruckner sich, wie auch schon weiter vorne bei „ante omnia, omnia saecula“ eine Wortverdoppelung, um die Aussage besonders zu unterstreichen. „Descendit“, heißt es nun in As – und von dort steigt Er einen weiten Weg hinab, zur Erde, g-Moll. – Doch so groß kann die Entfernung zwischen Himmel und Erde aus Bruckners Sicht letztlich nicht sein, denn G ist der nächstgelegene Ton, gleich unter dem As.
Die Stimmung wechselt nun total von der munteren Glaubensverkündigung zu einem „Moderato misterioso“, dem „Et incarnatus“, wo der Solo-Tenor, begleitet von Solovioline und Solobratsche sowie den Holzbläsern in der „himmlischen“ Tonart E-Dur von der Menschwerdung Gottes berichtet. Solist und Chor singen im Metrum, während die Soloinstrumente synkopiert, also gegen den Taktschlag, begleiten. – Ist das Bruckners Umsetzung des sprichwörtlichen „auf krummen Zeilen gerade Schreibens“? Die innige Musik führt den Solotenor durch die ausgiebig bediente Chromatik innerhalb weniger Takte in himmlisch entrückte Tonarten wie Gis-Dur (8 Kreuz) nach fis-Moll, a-Moll, As-Dur (4 b) und – durch einen enharmonischen Kunstgriff – nach Fis-Dur (6 Kreuz). Es geht hier offenbar darum, die Menschwerdung in allen verfügbaren Farben auszumalen. Der Chor leitet schließlich in ein schlichtes C-Dur über, bevor die Stimmung neuerlich umschlägt, ernüchtert, und mit dem „Crucifixus“ (Bruckner schreibt hier „Langsam“ vor) geradezu feierlich wird. Die Grundtonart E-Dur hat nun endgültig durch Rückung um einen Halbton nach unten (vgl. das Herabsteigen vom Himmel vorhin, von As nach g) nach Es-Dur gewechselt. Christus ist nun in einer anderen Sphäre, dem Himmel entrückt (E nach Es). Die Chromatik durchläuft nun „verminderte“ Tonarten wie Ces-Dur, B-Dur, Des-Dur und b-Moll. Chor und Bass-Solist wiederholen nun im Dialog, wie meditativ, immer wieder die Inhalte „etiam pro nobis“, „passus“, „sub Pontio Pilato“, bis der Chor die irdische Leidensgeschichte a cappella in einer Kadenz nach Es-Dur, pianissimo, beschließt. Die Blechbläser antworten, äußerst verhalten, mit 4 Takten Begräbnismusik, dem Echo des Grablegungs-Chores. Gestorben und begraben. Mit dem Tod ist jetzt die ganze Sache mit diesem Christus vorüber. Alles zu Ende.
Tod. Schweigen. Karsamstag. Doch irgend etwas passiert hier offenbar doch noch. Cello und Kontrabass spielen – pizzicato – genau 2 gleiche Töne, ein Es, vor dem Doppelstrich, doch eigentlich gehört das schon zum nun folgenden Teil, Allegro. Vorzeichenwechsel, Es-Dur ist Vergangenheit, doch schreibt Bruckner keine neue Tonart vor. Was nun kommt, ist zunächst ungewiss, sieht nach C-Dur oder a-Moll (keine Vorzeichen) aus, ist es aber nicht. Etwas ganz Neues, Unerhörtes, bricht sich hier Bahn. Pauke und das Pizzicato der tiefen Streicher intonieren E, also wieder eine Rückung um einen Halbton nach oben. Gott rückt in das Leben zurück (hinauf), was der Mensch (nach unten) in den Tod gezogen hat. Bruckner sagt damit wohl, dass Gott selbst die Vorzeichen unserer so sicher geglaubten menschlichen Existenz (geboren werden, leben, sterben, Schluss, aus!) ändert und somit unsere vermeintlich sichere Wirklichkeit ver-rückt. Da gibt es offenbar ein Danach, mit dem niemand gerechnet hat. „Mors stupebit“, heißt es im Text des Requiems: der Tod selber ist fassungslos. Die Violen beginnen mit der schnellen Achtelbewegung, die lediglich ein Gerüst aus E und der leeren Quinte H vorgibt und einen Klangraum auftut, ohne etwas über dessen Inhalt zu verraten. Holzbläser kommen hinzu, Bruckner schreibt „crescendo“ vor, dann „sempre crescendo“, die hohen Streicher stimmen ein, die Musik drängt stürmisch vorwärts, mehr Holz, das ganze Orchester erhebt sich unbändig zu neuem Leben. Innerhalb von 8 Takten ist etwas Ungeheuerliches, noch nie zuvor Dagewesenes passiert. Wir sind im Fortissimo, ein gewaltiger Klangraum ist entstanden, und noch immer keine Tonart. Der Stein ist weggerollt, doch ist noch niemand aus dem Grab herausgetreten. Etwas ganz Großes geschieht, sagt uns Bruckner, doch noch ist nicht enthüllt, was es ist. Jetzt erst deklamiert der Chor, worum es geht: „Et resurrexit“, er ist auferstanden! Bereits mit dem ersten Akkord des Chores mit den Blechbläsern ist klar: wir sind nun wieder in E-Dur, der himmlischen Tonart Bruckners. Wieder die Eröffnung göttlicher Weite, die Mittelsilbe „-re“ bleibt über 2 Takte hinweg liegen. „Et resurrexit“, wiederholt der Chor in den Jubel des Orchesters hinein. Niemals zuvor oder danach ist in der Kirchenmusik der zentrale Glaubensinhalt der Auferstehung so vertont worden. Man kann das alles immer noch glauben oder nicht. Aber wer dieses „et resurrexit“ aus Bruckners f-Moll-Messe miterlebt hat, hat verstanden, worum es bei der Auferstehung geht. Einen Glaubenssatz, einen Text, kann man diskutieren, bezweifeln, relativeren; aber nicht diese Musik!
All das spielt sich innerhalb relativ weniger Takte ab: schon kommen wir in lichtes A-Dur, „et ascendit in coelum“, „er ist aufgestiegen zum Himmel“, „sitzt“, „sedet“, wiederholt der Chor, färbt das Szenario nun um nach f-Moll und geht in der Erläuterung „ad dexteram Patris“ nach d-Moll. Wir sind nun wieder allein mit unserem irdischen Drama, der Auftritt Jesu auf Erden ist definitiv vorbei. 4 Takte lang bleiben wir scheinbar ohne Beistand, bis der Chor ankündigt: „et iterum venturus est“, „er wird wiederkommen“, wiederholen die Stimmen und setzen einen musikalischen Doppelpunkt, um zu erklären, wie das geschehen soll: „cum gloria – cum gloria“, „mit Herrlichkeit“, dreifaches Forte. Herrlichkeit, für manche auch Schrecklichkeit – das erste „cum gloria“ steht in Des-Dur, das insistierend wiederholte aber in b-Moll, und die Posaunen zeigen die Bewegung nach unten. Der Schrecken (b-Moll) bleibt, denn nun wird erklärt, was dann passiert. Die Wiederkunft hat einen Zweck: „judicare“, „zu richten“, wiederholt der Chor immer wieder, geht aber beim zweiten gemeinsamen „judicare“ nach Des-Dur; damit ist klar, wer der Richter sein wird (wir erinnern uns: Des-Dur, Tonart des Göttlichen). Weltgericht, ein Durcheinander von Stimmen, immer wieder „judicare“, und zwar „judicare vivos“, man weiß nicht, wie das ausgehen wird, die Hörner bäumen sich immer wieder auf, kommen aber nicht weit, denn die aufsteigende Figur geht wieder an den Ausgangspunkt zurück, Unbestimmtheit also, keine klare Richtung; doch klingt der Chor hier nicht bedroht und in Angst und Schrecken. Er sehnt dieses Gericht Gottes geradezu herbei, wie einen Befreiungsschlag, der von den irdischen Bedrängnissen erlöst. Das steht ganz in der Tradition eines sehr alten Gebets der Kirche: „per iudicia tua libera nos, Domine“ – „durch Deine Urteile befreie uns, o Herr“. Gericht also nicht als Bedrohung verstanden, sondern als Befreiung, Erlösung. Und noch einmal „judicare vivos“ – „et mortuos“, wird im Pianissimo angefügt: selbst die Toten werden hier Rede und Antwort stehen.
Szenenwechsel, das Weltendrama ist vorbei. Relativ nüchtern berichtet Bruckner nun in a-Moll von der Herrschaft, die kein Ende haben wird. „non erit finis“, wiederholt im Pianissimo der Bass, begleitet von den hohen Holzbläsern. Wir bekommen hier bereits einen Vorgeschmack auf eine himmlische Sphäre, die später im Sanctus musikalisch entfaltet wird.
Das Credo für die dritte göttliche Person („et in Spiritum Sanctum“) setzt nun – theologisch völlig konsequent – wieder mit dem Eingangsmotiv des Satzes an. Bruckner widmet dem Heiligen Geist einen musikalischen Einschub in den Fluss des Credo, einen Hymnus der Solisten mit dem Chor, wobei diese sich keineswegs in derselben Tonart bewegen. „qui locutus est per prophetas“: mit vielen verschiedenen Stimmen hat er zu uns gesprochen, durch die Propheten. Das drückt Bruckner hier mit dieser scheinbar beziehungslosen Mehrstimmigkeit aus.
Streng und rigoros wird die Musik wieder, wenn (fast nur im Unisono) der irdische Teil des Glaubensbekenntnisses beginnt: „et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“. Beim Bekenntnis „et expecto“ setzt Bruckner wiederum den „et resurrexit“-Jubel von vorher ein, denn erwartet wird „resurrectionem“, und zwar „mortuorum, was durch ein Pianissimo ritardando des nur von der Pauke begleiteten Chores und den Blechbläsern illustriert wird: die Toten in ihren Gräbern.
In den letzten Teil des Credo, C-Dur, „et vitam venturi saeculi“ fallen immer wieder die freudig zustimmenden „credo, credo“-Rufe des Chores ein. Auch das ewige Leben ist eine farbenreiche Angelegenheit und geht durch verschiedene Tonarten, bis der Satz schließlich mit dem gedehnten Credo-Hauptthema abschließt.
Sanctus
In eine völlig neue, vorher bereits im „non erit finis“ angedeutete Klangwelt tauchen wir mit dem „Sanctus“, F-Dur. Ganz vorsichtig, wie auf Zehenspitzen, betritt der Chor ehrfürchtig diesen Raum der Heiligkeit; zögerlich steigern sich die „Sanctus“-Rufe bis zum Ausbruch „Dominus Deus“. Doch es wäre nicht Bruckner, wenn diese Heiligkeit gar so einfach gestrickt wäre. Ganz wie bei Schubert, der den Gedanken in seinen beiden großen Messen (erstmals in Messvertonungen überhaupt) durch scharfe chromatische Kontraste bei den Sanctus-Rufen deutlich macht, liegen auch hier das Herrliche und das Schreckliche im Heiligen unmittelbar nebeneinander. Innerhalb des „Dominus“-Anrufs taucht Bruckner von C-Dur bei „Sabaoth“ kurz in das abgründig-finstere f-Moll ab. „Pleni sunt coeli“ – womit? Voll von „gloria“ – der Herrlichkeit Gottes. Diese steht wieder gegen den Textfluss weit, aber nicht unbewegt, ausgedehnt über 3 Takte. Die freudigen Hosanna-Rufe, eingeleitet vom Solo-Sopran, werden vom Chor und den anderen Solisten beantwortet und von schnellen Streicherfiguren und Fanfarenstößen der Trompeten begleitet, und enden triumphal im Fortissimo.
Benedictus
„Von Vielen zu spielen“ schreibt Bruckner als Anmerkung zur Cello-Einleitung des Benedictus-Satzes (in As-Dur), hat dabei also wohl nicht an ein Solo-Cello oder an 1 Pult (2 Spieler) gedacht. Die Solisten übernehmen nacheinander die Melodie, wobei der Bass-Solist mit einem zweiten, ernsteren „Benedictus“-Thema antwortet. Die 1. Geigen stellen ein drittes Thema, eine Auf- und Abbewegung, vor, das vom Solo-Sopran übernommen wird, der Satz wird nun immer meditativer, der Chor bedenkt den „Hochgelobten“ verhalten im Pianissimo, Des-Dur, Ges-Dur – es wird immer einsamer um den Messias. Schließlich winden sich, während alle anderen schweigen, die Violinen in einem äußerst heiklen Lauf in die lichtesten Höhen, die das Instrument hergibt. Bruckner verlangt den ersten Geigern hier philharmonische Qualität ab: 9 Takte echte Zitter-Partie in jeder Aufführung. Die Luft ist sehr dünn da oben, für den, der da kommt im Namen des Herrn. – Reprise, erneut das 1. Benedictus-Thema, diesmal im Chor, der das „in nomine Domini“ in einer Steigerung von As-Dur kurz nach C moduliert, bekräftigt. Die Gewissheit: er kommt im Namen des Herrn. Doch sofort rückt der Chor wieder nach As-Dur, der Satz wird erneut meditativ, und am Ende bricht Bruckner gar der Fluss des Metrums, dreimal. Ausdrücklich im Largo buchstabiert er hier nochmals „Benedictus“. In den wenigen Takten auf dem Weg zum „Hosanna“ ändern sich Farbe und Stimmung komplett, von As-Dur nach A.
In der Sieger-Tonart D-Dur beginnt der Solo-Sopran die Hosanna-Rufe. Der Palmsonntag hat jedoch eine Schattenseite: Jesus auf dem Weg zu Auslieferung und Kreuzigung. Der Solo-Alt wendet die Stimmung in die Todes-Tonart g-Moll, auch die Hosanna-Rufe des Chores und das Orchester werden dadurch bedrohlich. Aber noch ist Palmsonntag: der Satz schließt in freudigem F-Dur.
Agnus Dei
Meditativ und innig beginnt das „Agnus“ in f-Moll mit einer Orchestereinleitung. Den Frauenstimmen in f-Moll antworten die Herren mit einer Abwärtsbewegung nach Ges-Dur. „Miserere“, „erbarme Dich“, schlägt der Solo-Bass musikalisch fast unbewegt vor. Die Anrufung wird von den anderen Solisten aufgegriffen, gesteigert, und mündet in der Forderung des Chores im Fortissimo. Ganz ähnlich aufgebaut die zweite, jetzt schon in Es-Dur beginnende, Agnus-Anrufung. Für die dritte geht der Chor aber nicht mehr ins Piano zurück. Der flehende Charakter ist nun von einer Gewissheit ersetzt, mit wem man es hier zu tun habe. Diese dritte Agnus-Anrufung kann in Bruckners Logik (und der der Tonarten-Sprache) nur in der „göttlichen“ Tonart Des-Dur stehen. Zögerlich, fast bangend, nun die Bitte um den Frieden: „dona, dona“, wiederholt der Chor, und steigert ins Fortissimo über D- („dona“) schließlich in jubelndes C-Dur („pacem“). Freilich sind hier noch nicht alle Aspekte ausgelotet. Überraschend kippt Bruckner die Tonart – und die Stimmung – wieder nach As, pianissimo, „dona nobis pacem“, geht aber sogleich wieder nach C. Was hier nach spitzfindigem Tonarten-Verfolgen klingen mag, ist aber Bruckners theologische Klangsprache: innerhalb eines einzigen Taktes, eines Augenschlags, kann Gott alles zum Besseren, zum Frieden wenden. Noch einmal steigern sich die „Dona“-Rufe, und Bruckner greift für den abschließenden Unisono-Ruf des Chores das „(in) gloria Dei Patris, amen“-Fugenthema vom Ende des Gloria wieder auf und stellt damit die Verbindung von der dort angerufenen Herrlichkeit Gottes mit dem nun erlangten Frieden her. Ein letztes Mal wechselt die Stimmung, wird äußerst ruhig, elegisch, fast wie eine ferne Rückschau auf das vorher Gewesene. Mit einem letzten „Dona nobis pacem“ des Chores, F-Dur, endet der Satz selig im Pianissimo.
Vielleicht konnte ich ein wenig verdeutlichen, dass es Bruckner darum ging, jeden einzelnen Satz, jede Phrase, mit den ihm gegebenen musikalischen Mitteln so auszuformen, zu gestalten – ja vielleicht: zu codieren, dass Glaubensinhalte sich dem aufmerksamen Hörer anders als auf der textsprachlichen Ebene des Messordinariums erschließen können. Er war sich dieses Talentes, dieser einzigartigen Gabe im Dienst der Verkündigung, bei all der ihm nachgesagten Bescheidenheit, Schlichtheit, wohl durchaus bewusst. Über das „Te Deum“, sein theologisches opus summum, hat er ja gesagt:
„Wenn mich der liebe Gott einst zu sich ruft und fragt: ‚Wo hast du die Talente, die ich dir gegeben habe?‘, dann halte ich ihm die Notenrolle mit meinem Te Deum hin, und er wird mir ein gnädiger Richter sein.“
Gott ist ganz bestimmt auch schon mit der f-Moll-Messe sehr zufrieden gewesen.
Martin Filzmaier