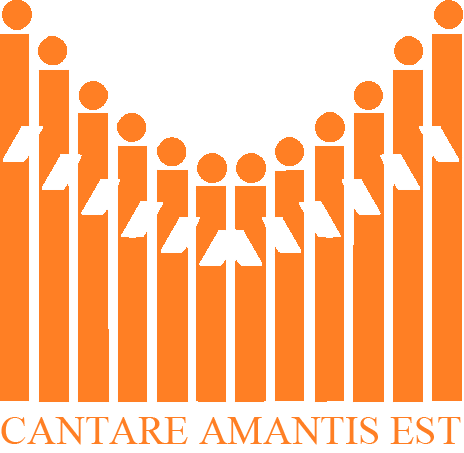Der November ist für uns meistens die Zeit der höchsten Aktivität im Kirchenjahr: wir singen gleich 5 Messen, wobei einige davon sehr hohe Ansprüche an den Chor stellen. Das wäre normalerweise keine große Sache; solche Herausforderungen sind wir gewohnt. Allerdings werden wir gerade – so wie halb Österreich – von einer Erkältungswelle überrollt, die vielen unserer Sängerinnen und Sänger die Stimme raubt und so von der Mitwirkung abhält. Wir singen derzeit mit stark reduzierter Besetzung, haben aber einiges vor uns:
Zu Allerheiligen wird wie auch schon am letzten Oktobersonntag bei Haydns Schöpfungsmesse Andrés Garcia die Aufführung der Nikolaimesse leiten. Eine Zusammenarbeit mit ausgewählten anderen Chorleitern, ständigen Gastdirigenten, kann für den Chor eine Bereicherung durch andere Herangehensweisen sein, und bringt für die Messbesucher neue Aspekte der Interpretation. Bei der Schöpfungsmesse hat das sehr gut und beglückend funktioniert.
Michael Haydns wunderbares Requiem c-Moll für den von ihm sehr geliebten Fürsterzbischof Sigismund von Schrattenbach ist ein zu selten gespieltes Werk, das wohl zu Recht als „die prototypische Requiemvertonung des 18. Jahrhunderts“ (P. Maly) bezeichnet wird. Durch den Zusammenfall des Allerseelenfestes mit einem Sonntag haben wir die Möglichkeit, es im Rahmen unserer Sonntagsgottesdienste liturgisch zur Aufführung zu bringen.
In Schuberts bahnbrechender Großen Messe in As verlangt unter vielem anderen die schwierigste Chorfuge der Messliteratur (A. Pixner) dem Chor so einiges ab. Klein besetzt kann man so ein Werk kaum singen, und wir hoffen, dass sich das mit dem erkältungsbedingten Chorschwund bis Christkönig erledigt haben wird.
Der letzte Sonntag des Novembers ist auch schon der 1. Adventsonntag. Es folgt dann eine etwas ruhigere Zeit für den Chor, dennoch mit den Höhepunkten „Waisenhausmesse“ und „Missa Papae Marcelli“.
Herzlichst, Ihr
Martin Filzmaier
Samstag, 1. November 2025 – Allerheiligen: Joseph HAYDN – „Nikolaimesse“
Die päpstliche Enzyklika „Annus qui“ von 1749 verlangt, Kirchenmusik als Dienerin des Wortes zu verstehen. Joseph Haydn trug den Bestimmungen Rechnung, indem er zwar die Instrumentierung zurücknahm, dem liturgischen Text aber in der „Missa Sancti Nicolai“ menschliche Empfindungen zuordnete. Schließlich sollte die Musik auch dem Auftraggeber, Fürst Nikolaus I. Esterházy gefallen, zu dessen Namenstag die „Nicolai-Messe“ komponiert wurde. So ist eine wohlklingend heitere Pastoralmesse entstanden mit schönen, mehrstimmigen Passagen und eingängigen Melodien für die Solisten.
Das Kyrie klingt nicht nach bußfertigem „Erbarme dich“. Die beinahe volkstümliche Melodie drückt Freude über den Beginn der Liturgie aus. Im Gloria singt die Sopransolistin ein großangelegtes „Gratias agimus tibi“. Große Einzelsoli findet man auch im „Credo“ nicht. Ein Quartett tritt an die Stelle, in dem der Tenorsolist durch das Glaubensbekenntnis führt. Der Solo-Bass tritt in einen spannenden Dialog mit Sopran und Alt. Diese wunderbare Gegenüberstellung von Chor und dem Solistenensemble gehört zu den herausragenden Momenten der Messe. Spielerische Terzen bestimmen das „Sanctus„. Haydn nimmt den Chor zurück, überlässt der Violine die Melodieführung und gibt den Hörnern klangmalerische Aufträge. Im „Benedictus„, lässt Haydn das „Gepriesen sei der Herr“ wieder variantenreich durch die vier Solostimmen verkünden. Beim „Agnus Dei“ wirken Solisten, Orgel und Orchester klangmächtig zusammen, die mitreißende Wucht des Chores feiert das Lamm Gottes.
Quelle: Werner Vogel/inFranken.de
Die Solisten sind Cornelia Horak, Angela Riefenthaler, Gernot Heinrich und Felix Pacher.
Die Musikalische Leitung hat Andrés Garcia als Gast.
Zum Offertorium singt der Chor „Ave verum“ von Camille Saint-Saens (1835-1921).
Sonntag, 2. November 2025: Allerseelen
Michael HAYDN – „Schrattenbach-Requiem“ MH 155
Das Requiem in c-Moll von Michael Haydn entstand unmittelbar nach dem Tod des Salzburger Erzbischofs Sigismund III. Christoph von Schrattenbach am 16. Dezember 1771. Es wurde anlässlich der Exequien des Erzbischofs am 1. Januar 1772 aufgeführt und trägt deshalb auch den Namen Missa pro defuncto archiepiscopo Sigismundo bzw. „Schrattenbach-Requiem“. Das Werk entstand aber auch unter dem Eindruck der persönlichen Trauer: Haydns einziges Kind, Aloisia Josepha, war im Januar 1771 noch vor Vollendung des ersten Lebensjahres gestorben.
Haydns Requiem ist für vier Vokalsolisten, vierstimmigen gemischten Chor (SATB), Trompeten, Posaunen und Pauken, Streicherensemble und Basso continuo gesetzt. Die durchschnittliche Aufführungsdauer der Totenmesse beträgt 35 Minuten.
Nach Aufzeichnungen der Salzburger erzbischöflichen Hofkapelle haben sowohl der damals fünfzehnjährige Wolfgang Amadeus Mozart als auch sein Vater Leopold bei der Uraufführung von Haydns Requiem im Orchester mitgewirkt – ersterer an der Bratsche, letzterer an der Violine. Der junge Mozart „war von dem Werk beeindruckt und nahm es sich später – wie einige offenkundige Anklänge zeigen – für sein eigenes Requiem zum Vorbild.“
Reinhard G. Pauly, Verfasser einer Dissertation über die lateinischen Messen von Michael Haydn, hat auf spezifische Ähnlichkeiten der beiden Totenmessen hingewiesen. Dazu zählen unter anderem die rhythmische Ausgestaltung des Introitus, der Gebrauch des Tonus peregrinus in Te decet hymnus sowie die Abschnitte Quantus tremor und Confutatis maledictis im Dies irae. Vor allem die überraschende Ähnlichkeit des Fugenthemas Quam olim Abrahae weist darauf hin, dass Franz Xaver Süßmayrs abschließende Niederschrift des Requiems nach Mozarts Tod „in keiner Weise von Mozarts ursprünglichen Plänen abweicht.“
Quelle: wikipedia
(mehr zur Biographie Michael Haydns im letzten Beitrag dieses Newsletters)
Diese Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Martina Steffl, Gernot Heinrich und Klemens Sander.
Sonntag, 9. November 2025: W. A. MOZART – „Große Credomesse“ KV 257
Wie schon bei der Missa brevis in F, KV 192, „Kleine Credomesse“ genannt, folgt Mozart auch hier einer bis in die Barockzeit zurückzuverfolgenden Gattungstradition, wenn er im Credo die Worte „credo, credo“, gleichsam bekräftigend zwischen der Aufzählung der Glaubenswahrheiten wiederholen lässt. Während er das in KV 192 mit einem streng und glaubensfest wirkenden Thema macht, will er hier mit Charme überzeugen. Er wiederholt auch beide Worte gemeinsam, sodass sie wie eine bekräftigende Wechselrede (credo, credo – credo, credo) wirken. Warum diese in C-Dur stehende Messe und nicht die in F-Dur-Messe, KV 192, den Beinamen „Credo-Messe“ erhalten hat, ist leicht zu erklären: Mozarts neun Messen in C-Dur haben zur Unterscheidung Beinamen gebraucht, die eine in F-Dur aber nicht.
1992 publizierte Papieruntersuchungen haben die Messe auf November 1776 datieren lassen, womit man annehmen kann, dass es diese Messe war, die am 17. November 1776 zur Bischofsweihe des mit der Familie Mozart befreundeten Koadjutors und Administrators der Diözese Brixen, Joseph Graf von Spaur, im Salzburger Dom erklungen ist und mit der von Leopold Mozart so genannten „Spaur-Messe“ zu identifizieren ist. Diese Ansicht hat der österreichische Musikhistoriker Erich Schenk (+1974) schon in den 1950er-Jahren mit guten Argumenten vertreten. Aber der schon lange eingeführte Beiname „Credo-Messe“ wird dennoch nicht durch den Beinamen „Spaur-Messe“ ersetzt.
Jedenfalls hat Mozart mit diesem Werk eine Festmesse voll innerer Größe geschrieben, ohne Fugen, aber mit etlichen außergewöhnlichen Einfällen. Zu diesen gehört neben den beschriebenen Credo-Rufen und den über einem Klangteppich der Violinen und Oboen (ohne Bass!) nur von Sopran vorgetragenen „Gloria in excelsis Deo“-Rufen auch der zweimalige obligate Einsatz der Posaunen im Agnus Dei. Diese drei Instrumente, die immer mitspielen, aber nie solostisch hervortreten, spielen am Ende des Satzes zweimal eine ganz exponierte Dreiklangzerlegung, die damals sicher jeden aufhorchen hat lassen. Serenadenklänge wurden schließlich dem Charakter des „Dona nobis pacem“ zugeschrieben, die sich aber spätestens dann als besondere Form einer seufzenden Bitte verstehen lassen, wenn man gehört hat, wie damit die Messe im Piano ausklingt.
Text aus „Mozart Sakral“ Wiener Mozartjahr 2006.
Solisten: Monika Riedler, Martina Steffl, Daniel Johannsen und Yasushi Hirano.
Zum Offertorium singt der Chor „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartholdi.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, MWV B 45, ist eine Vertonung des 100. Psalms von Felix Mendelssohn Bartholdy für Doppelchor a cappella. Er schrieb die Motette 1844. Es ist Mendelssohns bekannteste Vertonung des Psalms, der außerdem 1847 eine vierstimmige Motette schrieb, als Teil der Drei Motetten, op. 69, die zum Gebrauch in der Liturgie der Church of England bestimmt waren. Mendelssohn war bereit, Stücke für unterschiedliche Glaubensrichtungen zu komponieren.
Der Satz von Psalm 100 in Martin Luthers Übersetzung für Doppelchor wurde für die erneuerte Liturgie am Berliner Dom geschrieben. Friedrich Wilhelm IV. hatte Mendelssohn als Kirchenmusikdirektor von Berlin eingesetzt mit der Aufgabe, eine neue Liturgie einzuführen. Mendelssohn beendete die Psalmkomposition am 1. Januar 1844.
Aus „Wikipedia“.
Christkönigsonntag, 23. November 2025: Franz SCHUBERT – Messe in As-Dur, D 678
Die Messe As-Dur ist eine Missa Solemnis und die fünfte der insgesamt sechs Kompositionen, in denen Franz Schubert das Ordinarium vertont hat. Die Besetzung besteht aus einer Flöte, je zwei Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern und Trompeten, drei Posaunen, Pauken, Streichern und Orgel sowie vier Vokalsolisten und Chor. Der Umgang mit den Blasinstrumenten unterscheidet sich deutlich von den früheren Werken, und das vor allem bei dem völlig idiomatischen Einsatz der Holzbläser.
Im Kyrie beantworten die Tenöre und Bässe die beiden Oberstimmen. Das Christe eleison wird vom Solosopran eröffnet, dem die andern Solisten folgen. Das zweite Kyrie ist subtil verändert, und das Christe eleison ist gebührend transponiert.
Das Gloria mit der Vortragsanweisung Allegro maestoso e vivace steht in einem kraftvollen E-Dur und moduliert nach A-Dur, um das Andantino des Gratias agimus tibi vorzubereiten, das die ersten und zweiten Violinen noch vor den Solisten intonieren. Beim Dominus Deus, Rex cælestis moduliert die Musik nach a-Moll und in weitere Tonarten, bevor sie wieder nach A-Dur gelangt. Die anschließende Passage entwickelt sich bei den Worten Domine Deus, Agnus Dei zu einer Fuge in cis-Moll, und der Text des Cum Sancto Spiritu wird entsprechend der Tradition vollständig fugiert (diesem Satz hat Schubert 1826 unter Verwendung eines verbesserten Themas die hier vorliegende Gestalt gegeben).
Das Credo beginnt mit einem C-Dur-Akkord der Hörner und Posaunen, der von Oboen, Klarinetten und Trompeten beantwortet wird. Auf die Wiederholung des nämlichen Akkords folgt das im Chor achtstimmige Et incarnatus est in As-Dur, das in kühner Harmonik durch die Tonarten hindurch moduliert wird. Erneut erklingen die beiden Akkorde, wenn sie das Et resurrexit in C-Dur markieren sollen, und noch einmal treten sie vor dem Confiteor in unum baptisma in Erscheinung.
Das Sanctus in F-Dur ist bereits Welten von Joseph Haydns Messen entfernt, die Schubert als Chorsänger kennengelernt haben dürfte. Es stellt, ähnlich dem Sanctus der späteren Es-Dur-Messe, die ausführlichste Thematisierung des „mysterium tremendum et fascinosum“ dar: das Heilige als „schreckliches“, ehrfurchtgebietendes Geheimnis! Darauf folgt ein Hosanna in excelsis, das nach einer turbulenten Jagd klingt.
In das nun wieder in As-Dur stehende Benedictus teilen sich Sopran, Alt, Tenor und Chor, die von einer eilenden Achtelbewegung (zunächst in den gezupften Celli) begleitet werden. Am Ende des Satzes wird das Hosanna wiederholt.
Die Solisten eröffnen das Agnus Dei in F-Dur, worauf der Chor mit seinem gemurmelten miserere nobis ein beinahe schon „Verdisches“ Element präsentiert. Das Dona nobis pacem kehrt zur Ausgangstonart As-Dur zurück und bringt die Messe zu einem gehaltvollen Abschluss.
Text aus dem Internet, Autor unbekannt.
Es musizieren mit uns die Solisten Monika Riedler, Eva Maria Riedl, Gernot Heinrich und Stefan Zenkl
30. November 2025: 1. Advent
Michael HAYDN: Missa in tempore Quadragesimae MH 553 „Missa Adventus“
Michael Haydn, der jüngere Bruder von Joseph Haydn, wurde am 13. September 1737 in Rohrau an der Leitha, einem Dorf an der alten Grenze zwischen Niederösterreich und Ungarn geboren. Als Kind zeigte er so eine beachtliche musikalische Begabung, dass er 1745 in die berühmte Chorschule am Stephansdom zu Wien aufgenommen wurde. Als Gegenleistung für seine Dienste dort erhielt er nicht nur eine Grundausbildung in Musiktheorie und -praxis, sondern – und das war vielleicht noch wichtiger – er hatte dort auch die Gelegenheit, täglich die Musik der führenden Komponisten des 18. Jahrhunderts sowie anderer berühmter Meister, die ihre Dienste im Laufe der Jahre am Dom und kaiserlichen Hoforchester geleitet hatten, zu hören und zu spielen. Als er wegen Stimmbruchs die Chorschule verlassen musste (etwa um 1757), glänzte Haydn nicht nur als Geiger, sondern hatte auch eine solche Fähigkeit an den Tasteninstrumenten entwickelt, dass er den regulären Organisten bei Gottesdiensten in der Kathedrale vertreten konnte. Er hatte auch damit begonnen, sich als außerordentlich vielversprechender Komponist zu etablieren, und erfreute sich neben der Schirmherrschaft von verschiedenen Fürstenhäusern auch der eines Kreises von Klöstern im Hoheitsgebiet der österreichischen Krone.
Um 1759 trat der junge Musiker als Kapellmeister in die Dienste des Grafen Adam Patáchich ein, dem neuernannten Bischof von Großwardein in Südungarn (heute Oradea in Rumänien). Nach Ansicht seiner frühen Biographen war Haydns Gehalt dort so gering, dass er sich auf die Einkünfte aus seinen Kompositionen verlassen musste, um sich viele Lebensnotwendigkeiten leisten zu können. Vielleicht kündigte Haydn seine Anstellung beim Bischof aus eben diesem Grund im April 1762. Er war während des Sommers wieder in Wien, wo er bei den Konzerten der Tonkünstlersozietät mitwirkte.
Haydn kam während des folgenden Sommers nach Salzburg, wo er sich um eine Anstellung in den dortigen Diensten bewarb. Am 14. August 1763 wurde er durch erzbischöfliches Dekret in eine Doppelstelle als Konzertmeister und Hofkomponist mit einem monatlichen Gehalt von 25 Gulden aufgenommen. Zu Haydns Pflichten als Konzertmeister gehörte, dass er bei Gottesdiensten im Dom und in den fürstlichen Gemächern im Orchester spielte. Michael Haydn blieb bis zu seinem Tod 1806, also 43 Jahre lang, in diesem Dienst.
Michael Haydn nahm bald eine Vorrangstellung in der Kapelle ein. Man kann behaupten, dass er Cajetan Adlgasser und Leopold Mozart bei weitem übertraf und seine Begabung die Einzige war, die mit dem Genie des jungen Wolfgang Amadeus Mozart wetteifern durfte. Sein Talent fand ohne Zweifel seinen besonderen Ausdruck im Bereich der Vokalmusik. Er schuf eine Fülle von größeren und kleineren Kirchenwerken, Oratorien, sowie Gratulations- und Huldigungsmusiken. Er wirkte regelmäßig bei den Konzerten der Abtei St. Peter, den Benediktinerinnen auf dem Nonnberg und in den Klöstern Michaelbeuern, Lambach und Kremsmünster.
Mit der Zeit erfreute sich Michael Haydn bei einem internationalen Publikum einer beträchtlichen Berühmtheit als Komponist. Besonders bewundert wurden seine Kirchenwerke, welche Liebhaber wie Kenner für Muster ihres Stils hielten.
Der Katalog von Michael Haydns Kompositionen umschließt fast 850 Werke. Rund zwei Drittel seines Schaffens besteht aus Musik für die Kirche und umfasst einfache deutsche Motetten bis zu den prunkvollsten lateinischen Messen. Die letzteren nehmen einen besonderen Platz in Haydns Oevre ein, denn sie repräsentieren alle Perioden seines schöpferischen Lebens. Haydn schrieb insgesamt 38 Messen, sowie drei Vertonungen des Requiems.
Die drei zwischen dem 15. Februar und 31. März 1794 entstandenen Quadragesima-Messen MH 551-553, die zum allgemeinen Gebrauche während der Fastenzeit und unabhängig von irgendeinem Auftrag geschrieben wurden. Um 1790 wandte er sich ans Schreiben von einfacheren Kirchenwerken, welche den zeitgenössischen liturgischen Reformvorbildern angemessen waren.
Die Missa Tempore Quadragesimae (MH 553) beendete Michael Haydn am 31. März 1794. Zwar schließt das Werk nur ein einziges Zitat eines gregorianischen Chorals ein, nämlich im „Et incarnatus est“, aber es entspricht dur die Sparsamkeit seiner Mittel und dem ausgesprochen homophonen Stil im besonderen Maße den Ansprüchen der liturgischen Reform im Salzburg der 1790er Jahre.
Die autographe Partitur befindet sich in der Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliothek München, autographe Stimmen sind im Archiv der Benediktinerabtei St. Peter.
Eigenen Angaben zufolge war Haydn ein langsamer und methodischer Schreiber. Die Missa Tempore Quadragesimae ist von so einfacher Faktur, dass die Autographen völlig frei von Fehlern sind.
Charles H. Sherman im Vorwort der Partitur des Carus-Verlages 1995.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Nun komm der Heiden Heiland“. Nach dem Hymnus „Veni redemptor gentium“ des Bischofs Ambrosius (um 340 – 397), deutsch von Martin Luther 1524; Satz: Melchior Vulpius (1570-1615).