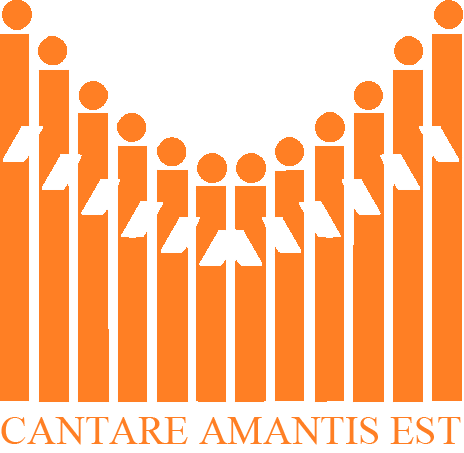Nachdem wir den September mit der opernhaften „Italianità“ einer sehr schön gelungenen und gut besuchten Aufführung von Puccinis Messa di Gloria“ ausgeleitet haben, folgt im Oktober ein kleiner Haydn-Schwerpunkt mit seinem „Stabat Mater“ und der 34 Jahre später entstandenen „Schöpfungsmesse“. Das Stabat Mater ist ein frühes Werk Haydns, das – vielleicht deshalb? – oft Erstaunen auslöst, weil es vielfach unterschätzt wird. Es hat „traurige“ Teile von berührender Innigkeit, aber auch fulminante, rasante Arien (besonders für den Bass-Solisten), verlangt speziell von der Sopransolistin virtuose Geläufigkeit in den Koloraturen, und hat freudig-jubelnde Teile (wie das „Paradisi Gloria“ am Ende). Man fragt sich dann: warum wird das nicht öfter gespielt? – Nun, wir hatten das Werk jetzt auch einige Zeit nicht im Programm, freuen uns aber auf wunderbare 70 Minuten Musik, wo wir unseren Solisten auch mehr zuhören dürfen als sonst; denn die haben im „Stabat Mater“ ein wenig mehr zu tun als wir im Chor.
Bei der Schöpfungsmesse, aber auch am Allerheiligentag mit der Nikolaimesse, setzt sich unser Bestreben fort, im Rahmen der Musikalischen Gesamtleitung von Andreas Pixner immer wieder auch Gastdirigenten einzusetzen. Diese bereichern erfahrungsgemäß die Chorarbeit und bieten oft andere als die inzwischen gewohnten Blickwinkel auf die gesungenen Werke. In unserem Folder finden Sie ein kurzes Interview mit Andrés Garcia zu seiner Motivation die Kirchenmusik betreffend, und mehr zu seiner Person auf den Seiten des Madigalchors https://www.neuer-madrigalchor.at/k%C3%BCnstlerische-leitung/ und auch der Volksoper https://www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/Garc-a_Andres_.de.php
Im Jänner wird dann Michal Kucharko, der in der Vergangenheit bereits mit uns gearbeitet hat, eine der Messen dirigieren. Zu ihm dann im Jänner-Newsletter mehr.
Martin Filzmaier
Sonntag, 5. Oktober 2025: Antonio SALIERI – „Hofkapellmeister-Messe“ (1788)
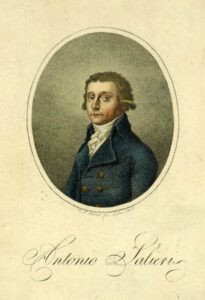 Antonio Salieri (* 18. August 1750 in Legnago, Italien; † 7. Mai 1825 in Wien) wurde zwar in Italien geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in Wien. 1766 kam er an den kaiserlichen Hof. Salieri blieb für den Rest seines Lebens in Wien; im Oktober 1774 heiratete er und wurde Vater von acht Kindern. 1774 wurde Salieri kaiserlicher Kammerkomponist und Kapellmeister der italienischen Oper.
Antonio Salieri (* 18. August 1750 in Legnago, Italien; † 7. Mai 1825 in Wien) wurde zwar in Italien geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in Wien. 1766 kam er an den kaiserlichen Hof. Salieri blieb für den Rest seines Lebens in Wien; im Oktober 1774 heiratete er und wurde Vater von acht Kindern. 1774 wurde Salieri kaiserlicher Kammerkomponist und Kapellmeister der italienischen Oper.
Neben seiner aufzehrenden Tätigkeit als Hofkapellmeister verpflichtete sich Salieri noch zu zahlreichen weiteren Ämtern: Präsident der Tonkünstler-Societät, deren Konzerte er noch bis 1818 leitete. Er saß 1823 im Gründungskomitee des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde. Dadurch erwarb er sich bleibende Verdienste für die Musik in Wien.
In den ersten 30 Jahren seiner kompositorischen Karriere schrieb Salieri nur wenige kirchenmusikalische Werke, darunter die Messe D-Dur („Hofkapellmeistermesse“, 1788). Erst nach seinem Rückzug vom Musiktheater 1804 schuf Salieri sein sakrales Hauptwerk; neben zahllosen Offertorien, Gradualien, Litaneien, Hymnen u.Ä., die allesamt zur Aufführung in der kaiserlichen Hofkapelle bestimmt waren, finden sich auch mehrere bedeutende Messen und sein zur eigenen Totenfeier bestimmtes Requiem in c-Moll. In der sakralen Musik führte Salieri jenen typisch biedermeierlichen Tonfall des frühen 19. Jahrhunderts ein, der einen besonders starken Einfluss auf die Kirchenwerke seines Schülers Franz Schubert ausüben sollte.
Nach Salieris Tod 1825 begann mit Alexander Puschkins Dramolett „Mozart i Saljeri“ (1831) eine Tradition dichterischer Freiheit, Salieri – basierend auf Mozarts Behauptungen – in Verdacht zu bringen, die durch Peter Shaffers Bühnenstück und dessen Verfilmung „Amadeus“ von Milos Forman fortgesetzt wurde. In Ergänzung zu dem Mordvorwurf wird Salieri in diesem Film fälschlicherweise als mittelmäßiger Komponist, Intrigant und ältlicher Gotteslästerer dargestellt, obwohl er in Wirklichkeit nur 6 Jahre älter war und Mozart um 34 Jahre überlebte. Tatsächlich macht sein Gesamtwerk sein herausragendes Talent offenkundig, zahlreiche Zeitzeugen belegen Salieris äußerst liebenswürdige Art. Seine tief empfundene Religiosität wird von seinen Biographen nicht angezweifelt.
Eines seiner bekannten Werke ist die „Hofkapellmeistermesse“, die im Jahre 1788 entstand. Ein anspruchsvolles Werk, das in der Tradition der neapolitanischen Schule steht. Beeindruckend ist der Mittelteil des Gloria, der mit einer wunderbaren Melodie aufwartet. Kantable Melodik herrscht vor. Kontrapunktisch geformte Abschnitte finden sich im Kyrie, im Gloria und Dona nobis.
Text aus dem Internet, Autor unbekannt
Die Chorvereinigung nimmt das selten gehörte Werk, von dem es auch eine in der Jesuitenkirche entstandene CD-Aufnahme gibt, nach einer Pause von 13 Jahren wieder in ihr Programm auf.
Als Solisten hören Sie: Cornelia Horak, Kathrin Auzinger, Gernot Heinrich und Markus Volpert.
Zum Offertorium singt der Chor den Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kirchenkantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ (BWV 147) von J. S. BACH. Die Kantate ist in ihrer heute bekannten Form für den 2. Juli 1723, das Fest Mariä Heimsuchung, komponiert worden. Der Schlusschoral des zweiten Teils „Jesus bleibet meine Freude“ wird durch eine triolische Streichermelodie umrahmt und gehört zu den international beliebtesten Kompositionen Bachs, nicht zuletzt durch zahlreiche Bearbeitungen und Aufführungen im 20. Jahrhundert.
Donnerstag, 16. Oktober 2025: ABENDKONZERT (19:30)
Joseph HAYDN – „Stabat Mater“
Als Herbstkonzert 2025 bringt die Chorvereinigung das Oratorium „Stabat Mater“ von Joseph Haydn zur Aufführung. Als Kapellmeister der Familie Esterházy vertonte er im Jahre 1767 das mittelalterliche Gedicht „Stabat Mater dolorosa“, dessen Verfasser unbekannt ist und in welchem der Schmerz der Mutter Jesu um ihren gekreuzigten Sohn zum Ausdruck gebracht wird. Aus dem zehnstrophigen Gedicht komponierte Haydn zwölf Sätze für Soli, Chor und Orchester. Haydns Vertonung ist innig und ausdrucksstark. In der Abfolge von Arien, Duetten, Quartetten und Chören ist es eines von Haydns persönlichen „Lieblingswerken“, seine traurigste und besinnlichste Musik. Mit dieser Komposition erlangte Haydn zu seiner Zeit internationalen Ruhm und breite Anerkennung.
Wir haben dieses Oratorium zuletzt 2015, also vor zehn Jahren, aufgeführt. Normalerweise wird dieses Werk in der Fastenzeit bzw. Karwoche aufgeführt, doch auf Grund der frostigen Verhältnisse vor Ostern in der Jesuitenkirche wollen wir das unserem Publikum nicht zumuten und präsentieren es im Herbst. Das „Stabat Mater“ gehört zu den Hauptwerken Joseph Haydns. Es erfährt durch die Aufführung im sakralen Raum noch einmal eine Steigerung des Erlebens.
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Sopran; Kathrin Auzinger, Alt; Gustavo Quaresma, Tenor; Yasushi Hirano, Bass; Andreas Pixner, Dirigent.
Karten/Tickets: 0664 3366464
Abendkassa/Box office: € 45,-/40,-/35,-
Vorverkauf /Advance booking: € 38,-/33,-/28,-
Sonntag, 19. Oktober 2025: W. A. MOZART – „Kleine Credomesse“ KV 192 (1774)
Mozarts längste Missa brevis in F-Dur, die deutlich den Umfang dieser Form sprengt, ist datiert auf den 24. Juni 1774. Sie wird auch als „Kleine Credomesse“ bezeichnet. Mozart komponierte sie im Jahr 1774 für den Salzburger Dom, höchstwahrscheinlich für einen ganz normalen Sonntag. Der Chor wird nur von Streichern begleitet, die Aufgaben der Solisten sind auf kleinere Ensemble-Einwürfe zurückgedrängt. Mozart scheint die formalen Beschränkungen, die ihm auferlegt waren, als Aufgabe betrachtet zu haben, zu möglichst kreativen und interessanten Ergebnissen zu kommen. In der F-Dur-Messe ist die kontrapunktische Durchdringung besonders auffällig und reichhaltig. Für ausgedehnte Fugen war kein Platz, dennoch bringt er drei Fugati (Gloria- und Credo-Schluss sowie Osanna) unter. Von besonderer Machart ist das Credo, das durchgehend auf dem berühmten Vier-Ton-Motiv basiert, das Mozart schon in seiner ersten Sinfonie, aber auch in seiner großen Credo-Messe von 1776 und noch in seiner letzten Sinfonie, der Jupiter-Sinfonie, verwendete. Es durchzieht den ganzen Satz und ist besonders bei den immer wieder wiederholten „Credo“-Einwürfen, eingesetzt.
Text aus dem Internet, Autor unbekannt.
Diese Solist*en musizieren mit uns: Cornelia Horak, Katrin Auzinger, Gernot Heinrich und Stefan Zenkl.
Zum Offertorium hören Sie die Kirchensonate F-Dur, KV 244.
Diese Kirchensonate aus dem April des Jahres 1776 ist die erste von jenen fünf Kirchensonaten, in denen Mozart die Orgel konzertierend eingesetzt hat. Für Organisten ist interessant, dass Mozart das Orgelsolo ausdrücklich mit der „Copula allein“ gespielt wissen wollte, einem nicht lauten und flötenartig klingenden Register. Diese Registrierungsangabe ist vielsagend für die Intonation von Mozarts Orgel, die Akustik im Salzburger Dom sowie für die Balance und Dynamik in der damaligen Aufführungspraxis.
Sonntag, 26. Oktober 2025: Joseph HAYDN – „Schöpfungsmesse“
Innerhalbvon ca. sechs Wochen hat Haydn die „Schöpfungsmesse“ (Hob. XXII:13) im Jahre 1801 als fünfte der insgesamt sechs späten Missae solemnes – gleichfalls wie die übrigen fünf – im Auftrag seines Dienstherrn Fürst Nikolaus II. Esterházy de Galantha (1765 -1833), seit 1794 Chef des Hauses, komponiert. Den Anlass bot jeweils der Namenstag der fürstlichen Gemahlin Maria Josepha Hermenegild, Prinzessin von Liec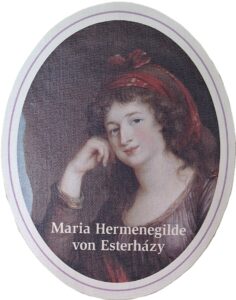 htenstein.
htenstein.
Der verhältnismäßig knappe Entstehungszeitraum für die umfangreiche Partitur ist durch zwei Eckdaten belegt: durch die autographe Eintragung des Datums „28. Juli 1801“ in die Partitur als Beginn der Kompositionstätigkeit und durch die Erwähnung der bevorstehenden Uraufführung in einem Brief vom 11. September 1801: „…ich möchte Ihnen recht gerne ein mehreres schreiben, aber eben bin ich armer alter Knab mit meiner neuen Meß, so übermorgen prodicirt werden muß beym Schluß…“. Demzufolge wurde die Messe am direkt nachfolgenden Sonntag auf den Namenstag der Fürstin, dem 13. September 1801, der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt, wahrscheinlich in der Bergkirche zu Eisenstadt.
Leider sind uns keine Aufführungsberichte über das Ereignis überliefert. Auf den großen Eindruck aber, den das Werk hinterlassen haben muss, we isen verschiedene Indizien. Kaiserin Maria Theresia von Bourbon-Neapel, die 2. Gemahlin des Kaisers Franz II., bekundete schon bald ihr Interesse an einer Abschrift der Messe und der Verlag Breitkopf&Härtel, Leipzig, druckte das Werk 1804 als Nummer vier von insgesamt sieben Partiturausgaben Haydnscher Messen mit einer Auflage von 1024 Exemplaren. Johann Adam Hiller (1728-1804) scrhrieb schließlich jene berühmt gewordenen Worte auf eine eigenhändig kopierte Abschrift der Messe: „Opus summum viri summi Joseph Haydn“.
isen verschiedene Indizien. Kaiserin Maria Theresia von Bourbon-Neapel, die 2. Gemahlin des Kaisers Franz II., bekundete schon bald ihr Interesse an einer Abschrift der Messe und der Verlag Breitkopf&Härtel, Leipzig, druckte das Werk 1804 als Nummer vier von insgesamt sieben Partiturausgaben Haydnscher Messen mit einer Auflage von 1024 Exemplaren. Johann Adam Hiller (1728-1804) scrhrieb schließlich jene berühmt gewordenen Worte auf eine eigenhändig kopierte Abschrift der Messe: „Opus summum viri summi Joseph Haydn“.
Der Beiname „Schöpfungsmesse“ ist zwar nicht authentisch, gründet sich wohl aber auf das Zitat im Gloria, Takt 152-160 (Textworte „Qui tollis peccata, peccata mundi“) aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ (Nr.32 Duett, „Der tauende Morgen, o wie ermuntert er!“).
Dabei konnte Haydn mit einem relativen Bekanntheitsgrad des Arienzitats rechnen, war doch geraume Zeit zuvor dieses Duett als Fragment in der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ bereits abgedruckt worden. Die Reaktion war entsprechend, denn Haydns Zeitgenossen meldeten Bedenken gegen die Aufnahme einer „tändelnden Melodie“ unmittelbar vor dem Miserere nobis in einer Messe an. Und tatsächlich hat Haydn die betreffenden Takte auf Begehren des kaiserlichen Hofes abgeändert, wie dies das Stimmenmaterial der Wiener Hofmusikkapelle bezeugt.
Nicht minder spektakulär gestaltet sich die Überlieferungsgeschichte der autographen Partitur selbst. Als gesichert gilt, dass Haydn als Akt der Dankbarkeit für eine vom Pariser Conservatoire verliehene Medaille die originale Partitur um 1802/1803 dieser Institution übermitteln ließ. Sie findet sich dann nochmals angezeigt in einem Auktionskatalog der Bibliotheque théorique des Musikverlegers Aristide Farrenc von 1866, wechselt auf der Auktion den Besitzer (Erwerb durch Dr. Hermann Härtel), gilt 1939 als endgültig verschollen und taucht 1954 im Antiquariat Erasmushaus (Basel) wieder auf. 1956 kaufte Dr. Günter Henle das Autograph und stiftete es der Bayerischen Staatsbibliothek, München. Leider befindet sich die Partition supplémentaire, in der die Stimmen für die Hörner, Trompeten und Pauken separat notiert waren, nicht mehr bei der Handschrift und dürfte endgültig verloren sein.
Haydn stand auf dem Höhepunkt seiner kompositorischen Entwicklung und konnte auf erprobte Techniken musikalischen Gestaltens zurückgreifen, als er sich mit der Komposition der Schöpfungsmesse beschäftigte. Das Durchkomponieren der einzelnen ordinarium-missae-Sätze (formale Geschlossenheit), die Verwendung des Soloquartetts anstelle virtuoser Arien, das Übertragen kompositorischer Erfahrungen aus der Instrumentalmusik
In die Vokalmusik (thematisch-motorische Arbeit im Sinne des „obligaten Akkompagnement“) und dies alles wiederum auf Grund eines ausdruckästhetisch verpflichtenden Denkens, waren ihm längst selbstverständliche kompositorische Mittel geworden. So bindet Haydn beispielsweise die langsame Einleitung des Kyrie durch motivisch-thematische Arbeit mit dem Kyrie-Motiv eng an den folgenden Allegro-Hauptteil. Den Einleitungscharakter unterstreicht er durch ein subtil eingesetztes und ausbalanciert instrumentiertes Fanfarenmotiv in den Instrumentalstimmen, das die Vokalstimmen, sich klanglich und dynamisch steigernd, begleitet und so einerseits eine feierliche Stimmung erzeugt und andererseits schon Aufmerksamkeit für das Folgende weckt. Das Christe eleison wechselt mit seiner Tonart Des-Dur gleichzeitig seinen Stimmungsgehalt und stellt wirkungsvoll Solo, Soloquartett und Chor gegenüber.
Galt dem Aspekt der thematisch-motivischen Arbeit im Kyrie mehr das analytische Interesse, so soll anhand des Gloria auf einen formalen Gesichtspunkt hingewiesen werden: Das Gloria hat Haydn häufig dreiteilig angelegt, wie auch bei dieser Messe, die jedoch insofern eine Besonderheit aufzeigt, als Haydn den ersten Teil als Ritornell gestaltet. Den Abschluss des Gloria bildet die glanzvolle Fuge „In gloria Dei Patris, Amen!“ (Takt 242-342), die im Amen-Teil in einen stark homophonen Satz zurückkehrt. Alle Möglichkeiten der Ausdruckssteigerung mittels gegenüberstellender Besetzung des Vokalparts mit Solisten oder Chor werden eingesetzt.
Am Credo lässt sich Haydns ausdruckstarkes Vermögen aufzeigen, Wort-Ton-Beziehungen auszukomponieren. Im ersten Credo-Abschnitt überlagert er gleich zu Beginn in stimmengekoppelter, versetzter Einsatzfolge von Tenore/Basso und Soprano/Alto die beiden Worte „Credo“ und „Deum“; für ihn wichtige Teile des Glaubensbekenntnisses vertont er grundsätzlich homorhythmisch, um die Textverständlichkeit zu erleichtern: das „descendit de coelis“ findet seine kongeniale, hörbare Ausgestaltung z.B. in der Einsatzfolge von hoher zu tiefer Stimmlage. Das „Crucifixus“ des von Tenor und Bass solistisch ausgeführten „Et incarnatus“ symbolisiert Haydn durch die melodische Linienführung des Solobasses in charakteristischer Kreuzform und gleichzeitig chromatisch absteigenden Violinen. Der Tutti-Einsatz von Chor und Orchester im Anschluss an das „Cruzifixus“ auf die Worte „Sub Pontio Pilato“ trägt seinen Teil zur Dramatisierung bei. Und die aufwärts eilenden Sechzehntelläufe der Streicher zu dem Wort „ascendit“, sowie die hoch-tief-Stimmenkopplung bei den Choreinsätzen beweisen erneut Haydns angewandtes Prinzip des „sprechenden Komponierens“. Der Einsatz der Blechbläser mit Fanfarenmotiven und die vom Chor in langen Notenwerten intonierten Worte „judicare vivos“ vermögen das Drohende des endzeitlichen Gerichts eindringlich zu verdeutlichen. Mit der Satzform des Fugato wird das ewige Leben „Et vitam venturi saeculi“ auskomponiert, bis schließlich der Satz mit einem jubelnden „Amen“ im homophon gehaltenen Chorsatz schließt.
Anhand des Sanctus, welches unter dem Aspekt Tempo und Figuration eine Parallele zum Sanctus der Nicolai-Messe aufweist, lässt sich zeigen, wie Haydn Grundforderungen der Liturgie und damit Forderungen an die gottesdienstliche Verwendbarkeit seiner Messen eingelöst hat. Die dreimalige Anrufung Gottes erhält durch die Bläser und gleichförmige Bewegung der begleitenden Streicher jenes feierliche Gepräge im Bekenntnis zu Gott, das der zeitgenössischen Liturgieauffassung entsprach. Ein Stimmungswandel vollzieht sich bei „Pleni sunt coeli“ und erreicht in kontinuierlichem Übergang seinen Zielpunkt des höchsten, ungebrochenen Jubels in Chor und Instrumentalbegleitung im “Osanna in excelsis“.
Im Benedictus komponiert Haydn eine erweiterte Rondoform, in der er seine musikalischen Einfälle besonders sorgfältig ausgestaltet.
Noch deutlicher bindet sich Haydn an die liturgische Norm im Agnus Dei. Mit zunehmender Intensität bei gleicher melodisch-harmonischer Substanz wird das Lamm Gottes angerufen; hingegen wird die Bitte „miserere nobis“ bzw. „dona nobis pacem“ in jeweils veränderter melodisch-harmonischer und instrumentierter Fassung formuliert. Eine im Tempo gemäßigte Überleitung bereitet die Schlussfuge „Dona nobis pacem“ vor, die mit ihrem chromatischen, modulationsfähigen Fugenthema an die Chorfuge im Gloria erinnert. Den Abschluss findet die Fuge in dem sich verbreiternden, langsam homophon werdenden Chorsatz mit der anhaltenden und eindringlichen Bitte: „Dona nobis pacem“!
Text (auszugsweise) aus dem Vorwort des Klavierauszugs von Volker Kalisch, Carus-Ausgabe 1983
Als Solisten wirken mit: Nicole Proksch, Martina Steffl, Franz Gürtelschmied, Yasushi Hirano
Dirigent: Andrés GARCIA, a.G.