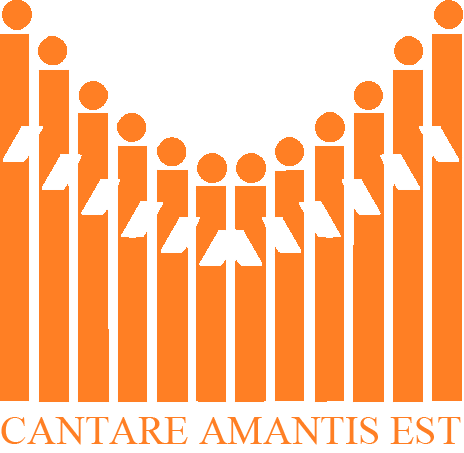Chorvereinigung St. Augustin in der Jesuitenkirche
NEWSLETTER NOVEMBER 2016
Liebe Freunde der Kirchenmusik!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Herbst brachte die Chorvereinigung einige besondere kirchenmusikalische Werke zu Gehör: so z. B. die Schöpfungsmesse von Haydn, die C-Dur-Messe von Beethoven, die Messe in As-Dur von Schubert und als Abendkonzert die Messa da Requiem von Verdi.
Die Aufführung der „Mariazellermesse“ von Haydn wurde für unsere neue CD mitgeschnitten. Eine Neuaufnahme dieser beliebten Messe ist notwendig geworden, weil die im Jahre 1975 von Amadeo produzierte Aufnahme nach 40 Jahren aus dem Katalog genommen wurde und unsere Lagerbestände zu Ende gehen. Nun kostet die Aufnahme einer CD in Studioqualität sehr viel Geld. Daher haben wir uns gedacht, einen Teil davon durch eine Subskription vorzufinanzieren. Unter dem Motto
Wer Haydn liebt, der gibt!
können Sie mithelfen und überweisen bitte € 15.- (inkl. Porto) und Sie erhalten nach Fertigstellung der CD (etwa in einem halben Jahr) diese zugeschickt – bitte Name und Adresse angeben.
Der November strebt nun dem Höhepunkt des 2.Halbjahres zu mit drei herausragenden Werken: Die Messe in F-Dur des 17-jährigen Schubert gehört zum Standardrepertoire des Chores und war zuletzt im Mai 2014 zu hören. Als Highlight im Herbst präsentieren wir zwei Messen von Anton Bruckner, die Messen in f-Moll und e-Moll, an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen – eine besondere Herausforderung für den Chor. Während die f-Moll-Messe erst voriges Jahr zu hören war (unter dem einspringenden Dirigenten Robert Rieder), stand die e-Moll-Messe zuletzt vor zwei Jahren am Programm. Ich denke, das ist ein fulminanter Höhepunkt der Saison spirituelle im zu Ende gehenden Kirchenjahr. Diese Kostbarkeiten der Wiener Kirchenmusik sollten Sie nicht versäumen! Unser Chormitglied Martin Filzmaier hat eine ausführliche theologisch-musikalische Deutung der beiden Messen im Anhang beigefügt. Scheuen Sie nicht vor der Länge zurück – es ist unbedingt lesenswert!
Hartwig Frankl, Obmann
Dienstag, 1. November 2016, Allerheiligen:
Joseph Haydn (1732-1809) „Große Orgelsolomesse“ Hob.XXII:04
Die Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae in Es-Dur (Hob. XXII:4), genannt „Große Orgelsolomesse“, entstand wahrscheinlich 1770, denn Wasserzeichen auf dem Autograph entsprechen denen seiner Oper „Le pescatrici“ von 1769. Außerdem sieht die Besetzung zwei Englischhörner vor; solche wurden von den Eszterházys erst 1770 erworben. Bemerkenswert ist der groß angelegte, virtuose Orgelpart, den Haydn selbst bei der Aufführung übernahm. Auch die Verwendung des Englischhorns war eine Besonderheit, denn diese Instrumente konnten auch das tiefe Es spielen. So steht die Messe in Es-Dur.
Die in Haydns ersten Jahren als Kapellmeister beim Fürsten Eszterházy entstandene Große Orgelsolomesse in Es-Dur zählt zu jenen Werken des Komponisten, die schon früh ausgesprochen weite Verbreitung fanden. Trotz des „dankbaren“ Orgelparts, der über weite Strecken solistisch behandelt wird, erlebt die für ein Marienfest komponierte „Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae“ heute nur selten eine Aufführung.
Das Werk hat nicht zu Unrecht einen sehr guten Ruf unter Kirchenmusikern wie auch bei Freunden der Wiener Klassik. Eine sehr schöne, überzeugende und ins Ohr gehende Musik, mit der Haydn, ähnlich wie bei seiner „Schöpfung“, ein geniales Werk gelungen ist, das Jahrhunderte überdauern sollte.
Die Solisten sind Sandra Trattnigg, Annely Peebo, Gernot Heinrich und Yasushi Hirano. (Frau Irena Krsteska übernahm dankenswerterweise das Sopransolo für die verhinderte Sandra Trattnigg.)
Der Chor singt das Offertorium für Allerheiligen „Justorum animae“ von Antonio Salieri (1750–1825).
Justorum animae in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum malitiae. Visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace. (Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand, und die Qual der Niedertracht rührt sie nicht an. Scheinen sie auch in den Augen der Unwissenden zu sterben, so sind sie aber doch im Frieden.)
Sonntag, 6. November 2016: Franz Schubert (1797-1828) – Messe in F-Dur, D 105
Die Messe Nr. 1 in F-Dur D 105 ist eine Messvertonung für Soli, Chor und Orchester von Franz Schubert aus dem Jahr 1814.
Schubert wurde in eine Lehrerfamilie hineingeboren. Schon bald wurde er von Michael Holzer, Chorleiter und Organist der Lichtentaler Pfarrkirche in der Wiener Vorstadt, im Violin- und Klavierspiel sowie im Gesang unterrichtet. Mit elf Jahren war er erster Sopranist in der Lichtentaler Kirche und war somit mit den Messen Mozarts und beider Haydn-Brüder bestens vertraut. Während dieser Zeit erhielt er Unterricht von Antonio Salieri im Wiener Stadtkonvikt. Gerade erst einmal 17 Jahre alt, wurde Schubert 1814 von Michael Holzer mit der Komposition einer Missa solemnis für das 100-jährige Jubiläum des ersten Gottesdienstes in seiner Lichtentaler Heimatgemeinde beauftragt.
Die Messe in F-Dur ist Schuberts erstes öffentlich aufgeführtes Werk. Bei der Uraufführung spielte sein älterer Bruder Ferdinand die Orgel, Franz Schubert selbst dirigierte und Josef Mayseder, der Konzertmeister des Wiener Hoforchesters, saß am ersten Pult. Schuberts Jugendliebe, Therese Grob, die auch bei den ersten Aufführungen der G-, B- und C-Dur Messe mitwirkte, sang das Sopran-Solo. Nach der Aufführung soll Antonio Salieri seinen Schüler umarmt haben mit den Worten: „Franz, du bist mein Schüler, der mir noch viel Ehre machen wird.“ Nur zehn Tage später, am 4. Oktober 1814 (Franziskustag), erklang die Messe in der Wiener Augustinerhofkirche. Für eine Aufführung im Frühjahr 1815 komponierte Schubert für ein alternatives “Dona nobis pacem” (D 185) eine neue Fuge, diese nimmt aber nicht mehr wie die Erstfassung Bezug auf den Kyrie-Satz. Wie in allen seinen lateinischen Messvertonungen lässt Schubert im Credo den Satz „Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ (deutsch: „[Ich glaube an] die eine heilige katholische und apostolische Kirche“) aus. (Wikipedia)
Als Solisten wirken mit: Monika Riedler, Katrin Auzinger, Alexander Kaimbacher und Yasushi Hirano.
Zum Offertorium hören Sie die Choralfuge „Ehre und Preis sei Gott, dem Herren“ von J.S.Bach.
Sonntag, 13. November 2016: Anton Bruckner (1824-1896) – Messe f-Moll WAB 28
Wenn die Arbeit der Chorvereinigung sich im November ganz besonders verdichtet, kann dies nur der ambitionierten Programmgestaltung des musikalischen Leiters geschuldet sein, der, was sonst keiner seiner Kollegen irgendwo machen würde, die beiden großen, mörder schweren Messen von Bruckner an 2 Sonntagen gleich hintereinander ansetzt. Aber keine Sorge, liebe Freunde der Chorvereinigung St. Augustin, das ist noch steigerungsfähig. Im nächsten Jahr soll auch die 1. große Bruckner-Messe, die in d-Moll, ins Repertoire gehoben werden. Bestimmt kommen dann alle 3 Messen an 3 Sonntagen hintereinander …
Was macht nun die besondere Herausforderung dieser Werke aus? Die Chorvereinigung kippt eine Dienstag-Probe zu Beginn der Adventzeit und probt stattdessen – unerhört! – an einem zweiten Tag in der Woche vor dem Bruckner-Hochamt. Auf eine eigene Gesamtprobe (mit Orchester und Solisten) am Samstag davor wird diesmal verzichtet, da wir das Werk erst vor einem Jahr aufgeführt haben; da sollte eine verlängerte Generalprobe am Sonntag vor dem Hochamt reichen.
Ziel ist jedoch immer, diese „Symphonie mit Chor“ den Intentionen des Komponisten entsprechend in größtmöglicher musikalischer Präzision bei höchstmöglichem Ausdruck des Inhalts für die Liturgie vorzubereiten.
Jetzt könnte ein Außenstehender meinen, ein solches Unterfangen wäre mit Müh’ und Plag’ verbunden. Die Musiker und Chormitglieder sehen das anders. Die Erarbeitung bzw. Präsentation eines solchen Werkes auf dem bei uns üblichen Niveau zieht Mitwirkende geradezu magisch an. Eine typische Reaktion eines Sängers aus einem anderen Chor ist zum Beispiel: „Ihr mochts die f-Moll? Bei die Jesuiten? Maah, brauchts no wem? Wenns no wem brauchts, sing i mit!“.
Freuen Sie sich also mit uns auf dieses ganz besondere Ereignis, einer Liturgie mit dem Größten, was die Kirchenmusik zu bieten hat, und mit Künstlern, die – so hoffen wir doch – dem hohen Anspruch des Werkes gerecht werden.
Solisten sind Cornelia Horak, Hermine Haselböck, Junho You und Yasushi Hirano (S/A/T/B).
Zur Werkeinführung selbst habe ich meinen Text aus dem Vorjahr in nur leicht adaptierter Form diesem Newsletter als Anhang 1 beigefügt. Viele werden ihn schon kennen. Für die anderen, oder zur neuerlichen Vertiefung, wird er hier am Ende nochmals aufgerollt.
Martin Filzmaier
Zum Offertorium: „Wer bis an das Ende beharrt“ von Mendelssohn.
Sonntag, 20. November 2016, Christkönigssonntag:
Anton Bruckner: Messe in e-Moll (Fassung 1882)
Messe Nr. 2 e-Moll für achtstimmigen gemischten Chor und Blasorchester (WAB 27)
Bruckners e-Moll-Messe ist nun gleich der nächste Grund für Mitwirkende, allfällige anderweitige Verpflichtungen wie Urlaube, Hochzeiten, Beerdigungen, Krankheiten oder andere unwichtige Vorhaben zu verschieben.
Das relativ Einfache bei den anderen Orchestermessen ist: Das Orchester unterstützt die Chorstimmen. Meistens. Das relativ Schwierige bei A-Cappella-Messen ist: Der Chor ist allein auf sich und seine Intonationsfähigkeit gestellt. Wo er jedoch am Ende „ankommt“, stört nur eine verschwindende Minderheit von Zuhörern mit absolutem Gehör. Das relativ Mörderische bei der e-Moll-Messe ist: Der Chor muss mit äußerster Präzision die Tonführung in der richtigen Höhe halten, denn nach gewissen A-cappella-Stellen setzen die Bläser gnadenlos auf ihrer richtigen Tonhöhe ein und enttarnen sofort einen doch nicht ganz so professionellen Chor, der glaubt, er könnte halt auch die e-Moll-Messe aufführen. Oder ernüchtern auch einen sehr guten Chor, wenn der gerade einmal einen schlechten Tag hat.
Wie auch bei der f-Moll-Messe, wenn auch aufgrund der Besetzung in intimerer, mehr meditativer Weise, entfaltet Bruckner hier einen Klangraum, der die gesamte Liturgie umschließt. Wieder bedient Bruckner sich der klassischen tonalen Farbenlehre, um die im Text vermittelten Inhalte zu verdeutlichen und mit Leben zu erfüllen. Als kleines Beispiel sei hier der Mittelteil des ersten Satzes, Kyrie, angeführt: das Christe eleison. Wie beiläufig beginnen die „Christe“-Rufe in D-Dur und verdichten sich in den 8 Stimmen immer weiter, bevor sie, durch die Bedrängnis von e-Moll hindurch schließlich jubelnd, fortissimo, im himmlischen, reinen H-Dur-Dreiklang enden. Hier steht kurz der Himmel offen, die Szene wird mit strahlendem Licht geflutet, und dann: Generalpause, Stille. Die Vision vom offenen Himmel ist zu Ende, wir sind wieder in irdischer Düsternis. Das neuerliche Kyrie beginnt wie der Anfang der Messe ganz ruhig, in nüchtern-dämmrigem e-Moll. Der Satz endet schließlich, ganz ähnlich wie das Kyrie der f-Moll-Messe, in äußerster Verhaltenheit – jedoch wie auch dort nicht niedergedrückt-resignativ, sondern in einer offenen, lauschenden Haltung.
Mehr Information zur interessanten Entstehungsgeschichte des Werks entnehmen Sie bitte dem Anhang 2 dieses Newsletters. Anhang 3 gibt einen schönen Überblick über die musikalische Gestaltung der Messsätze; und Anhang 4 schließlich ist ein Text, der uns nur im englischen Original vorliegt. Er gibt die Eindrücke eines – offenbar ganz gut informierten – Besuchers der e-Moll-Messe in der Jesuitenkirche im Jahr 2008 wieder: für die des Englischen Kundigen sicherlich ein Genuss.
Martin Filzmaier
Zum Offertorium singt der Chor „Die Himmel rühmen“ von L. v. Beethoven.
Anhang 1: zu Bruckners Messe f-Moll
Bruckners „Messe f-Moll“ ist für die Chorvereinigung St. Augustin in der Jesuitenkirche zusammen mit der Messe in e-Moll Abschluss und Höhepunkt des liturgischen Chorgeschehens in diesem Kirchenjahr. Sie war zwar seinerzeit, unter der Leitung Friedrich Wolfs, fixer Bestandteil des Chorrepertoires, verschwand jedoch nach Wolfs Rückzug in den Ruhestand für einige Zeit in der Versenkung. Mehr als 10 Jahren später war sie dann exakt 141 Jahre nach ihrer Uraufführung (16. Juni 1872, St. Augustin), nun unter Andreas Pixner, wieder in der Jesuitenkirche zu hören; danach am Christkönigssonntag 2015, und nun am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 2016.
Nun muss man zugeben, dass die Messe – mehr noch als andere Werke vergleichbarer Dimension – etwas tut, was Kirchenmusik eigentlich nicht sollte: sich gegenüber der Messliturgie in den Vordergrund stellen. Während auch die Chorvereinigung sich traditionell als eine Dienerin, Unterstützerin der Liturgie versteht, und eben nicht als Konzertchor, der im Rahmen der Liturgie seinen Auftritt hat, lässt die f-Moll-Messe eine solche Rolle beinahe nicht mehr zu. Zu gewaltig sind ihre inhaltlichen Dimensionen – und dabei ist nicht einmal die Länge des Werkes gemeint. Sie zieht die Ausdeutung des Mysteriums der Messfeier auf eine Weise an sich, welche die dienende Funktion der Musik überhöht und auflöst. Sie selbst ist es, die Vorsteher (Priester) und Mitfeiernde in einer Weise mit den Inhalten der Texte konfrontiert, dass ein „normaler“, routinemäßiger Ablauf der Liturgie unmöglich wird. Sie ist theologische Programmmusik auf höchstem Niveau, ist Evangelium, Bekenntnis und Verkündigung. In jeden einzelnen Takt hat Bruckner an den dichtesten Stellen der Komposition theologische Ausdeutung und Symbolik gelegt. – Ein wenig davon versuche ich weiter hinten in diesem Kommentar auszuführen.
Zur Werkgeschichte
Der damals noch (aus Wiener Sicht) in der Provinz, in Linz, ansässige Bruckner wurde 1867 nach dem Erfolg seiner d-Moll-Messe vom Obersthofmeisteramt beauftragt, eine Messe für die Hofmusikkapelle zu schreiben. Das Werk wurde von den Musikern jedoch prompt als unspielbar abgelehnt und somit zunächst „schubladisiert“. Bruckner wollte sich damit nicht zufriedengeben, mietete kurzerhand um 300 Gulden das Hofopernorchester und engagierte den Singverein, um das Werk, fast 5 Jahre nach seiner Entstehung, doch noch aufführen zu können. Dies geschah schließlich mit großem Erfolg, nach vielen Widerständen und mühsamer Probenarbeit, am 16. Juni 1872 in St. Augustin, bemüht dirigiert von Bruckner selbst, nachdem der Chef des Singvereins, Johann v. Herbeck, im letzten Moment die Nerven und das Dirigat geschmissen hatte.
Die Messe wurde dann von Bruckner immer wieder ein wenig nachbearbeitet, auch noch öfter unter seiner Leitung aufgeführt, blieb jedoch auf Grund ihrer außerordentlichen Anforderungen an Chor und Orchester für den „normalen“ Kirchenmusikbetrieb unspielbar und jenen wenigen Orten vorbehalten, welche die besten Sänger und Orchestermusiker zur Verfügung hatten.
Zum Inhalt der einzelnen Sätze
Eigentlich erübrigt sich ein Kommentar zum Inhalt eines gleichbleibenden, immer neu vertonten Textes. Bei Bruckner allerdings geht es nicht bloß darum, wie der katholische Messtext neu vertont wurde; er kleidet den Text musikalisch aus und bringt – wie z. B. im Credo – Glaubenswahrheiten zwischen die knappen Textzeilen, die an der jeweiligen Stelle gar nicht ausgesprochen, wohl aber mitgemeint sind. Oder er entwirft einen himmlischen, entrückten Klangraum – wie im Sanctus -, den der Text zwar als Deutung nahelegt, der aber von anderen Komponisten seit dem 15., 16. Jahrhundert so nicht mehr begangen wurde.
Die folgende Werkbesprechung soll ein wenig Einblick in die faszinierende Klang(ver)dichtung Bruckners und seinen gar nicht so (wie oft unterstellt wird) „einfältigen“ Glauben geben, die sich den meisten beim einmaligen Hören des Werkes leider kaum erschließen, weil wir normalerweise nicht gewohnt sind, so viel verdichtete Information aufzunehmen. Einstudierung und Proben der Messe gibt den Chormitgliedern die Möglichkeit, tiefer in die Feinheiten der Komposition einzudringen; so auch dem oftmaligen Hörer. Und auch wer bisher nichts mit Begriffen wie Chromatik und Tonartencharakteristik anfangen konnte, mag eine Idee davon bekommen, wie der Komponist hier ganz bewusst die verschiedenen Tonarten einsetzt und damit ein Klangbild entwirft, wie auch ein Maler einmal kräftige, helle oder dunkle Farbtöne, und dann wieder nur feinste Nuancen verwendet, um Wirkung und Stimmung zu erzeugen, um eine Geschichte zu erzählen.
Kyrie
Das Kyrie beginnt verhalten in dunklem f-Moll, die Kyrie-Rufe des Chores sind, in ihren absteigenden Linien, mehr Bitten als Anrufungen. Das Christe setzt in Es-Dur fort und steigert, von der Solovioline begleitet, kontinuierlich durch verschiedene Dur-Tonarten hindurch in ein strahlendes B-Dur – aber nur für den ersten Ton der Silbe „Chri-“; denn schon beim „-ste“ ist die Tonart durch Verminderungen und Hebungen in den Stimmlinien nicht mehr klar erkennbar. Wir sind bei diesem Ruf nach Christus musikalisch auf sehr unsicherem Boden, wie der zweifelnde Petrus, dem es nicht gelingt, wie sein Herr auf dem Wasser zu wandeln, der unterzugehen droht und nach Jesus um Hilfe ruft. Die „Christe“-Rufe fallen rasch ins Piano und nach d-Moll zurück, werden von den Solisten aufgegriffen und münden schließlich in die erste verlässliche, tragfähige Tonart, Ges-Dur. Der Höhepunkt des Satzes ist kaum erreicht, verklingen die Rufe nach nur 6 Takten auch schon wieder, und die Musik fällt in das verhaltene f-Moll des Anfangs zurück: die Reprise „Kyrie“. Die Entwicklung verläuft jedoch anders als beim ersten, fast zaghaften Kyrie-Ruf. Der Chor steigert aus dem düsteren f-Moll (4 vermindernde Vorzeichen) die Rufe bald zum anderen Ende der chromatischen Skala, in ein strahlendes E-Dur (4 erhöhende Vorzeichen) im Fortissimo. Wie so oft bei Bruckner wird an diesem kurzen Höhepunkt abgebrochen. Die Musik moduliert nun über 12 Takte zu einem neuen Ansatz: Kyrie-Rufe in f-Moll, wie gehabt? Nein: f-Moll diesmal lediglich mit einem einzigen Intervall, der Quart, wie ein Aufblicken nach oben; und nach 4 Takten eine Tonspaltung! F wird zu gleichzeitigem F und Ges, notiert als kleine Sekund, in Wirklichkeit aber eine übermäßige Prim – frühes Beispiel für Bruckners später (z. B. in der 9. Symphonie) wiederverwendetes Stilmittel, einen Ton dissonant zu spalten (die Sekund, zumal die kleine, ist traditionell die größtmögliche Dissonanz zweier Töne) und daraus eine neue harmonische Entwicklung zu beginnen. Nach 4 Takten musikalischer Ungewissheit folgt, analog zum „Christe“-Teil, die zweite tragfähige Tonart dieses Satzes, das „exotische“ Ces-Dur (7 vermindernde Vorzeichen): ein kurzer Jubel, fortissimo, von nur 8 Takten, dann subito pianissimo: das 4x pochende, unbegleitete Ces der Bässe ist nun, enharmonisch verwechselt (gleicher Ton, anders notiert – also nicht „derselbe“), ein H, somit Leitton von C-Dur, wo der Chor a cappella hingelangt, jedoch nur für einen Takt: ohne Modulation geht der Chor, immer noch unbegleitet, in das musikalisch sehr weit entfernte Ges-Dur und setzt von dort zum letzten Kyrie-Ruf in f-Moll an. Der Satz verklingt im Pianissimo, nachdem der Chor unisono auf der Dominante, dem C, endet: die Musik schließt nicht ab, der Chor lässt sie offen, hörend, auf die Antwort des Herrn.
Unbeantwortbar bleibt die Frage, wie weit Interpretationen dieser Art tatsächlich in der Intention des Komponisten lagen. Die Auffassung, dass der Komponist dies oder jenes immer ganz bewusst mit der Musik ausdrücken wollte, geht vermutlich in den meisten Fällen (und vielleicht noch am wenigsten bei Bruckner) in die Irre. Dort, wo solche Programmmusik tatsächlich passiert, entsteht meist ein Effekt, der heute oft als oberflächlich oder gar platt empfunden wird. So etwa im Credo, wo viele Komponisten schon in der frühen Klassik, und dann erst recht in der Romantik, bei der Zeile „judicare vivos et mortuos“, „zu richten die Lebenden und die Toten“, genau dort, wo die Toten angesprochen werden, den Fluss der Musik unterbrechen und das „et mortuos“ wie gleichsam aus der Gruft heraus geflüstert wird. An anderen Stellen ist die Intention nicht so offensichtlich, und ich behaupte, dass die wirklich großen Komponisten dem überkommenen liturgischen Text inhärente Wahrheiten erfassen und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ausdrücken konnten; Inhalte, die sich ihnen intuitiv, nicht aber von ihrer Erziehung und Ausbildung her erschlossen. Von dieser Auffassung her bitte ich, meine Interpretation hier als Annäherung an das Werk zu verstehen.
Gloria
Im Jubel des Gloria, fast ist man geneigt zu sagen, „natürlich“, in C-Dur, spannt Bruckner die Musik weit aus. Große Intervall- (meist Oktav-)sprünge innerhalb der Stimmgruppen, lange Liegetöne, oft unterlegt von raschen Unisono-Abwärtsbewegungen des Orchesters. So auch bei der Textstelle „pater omnipotens“, wo der gesamte Chor das „o“ von „omnipotens“ über 10 Viertelschläge hinweg hält – eine kaum endenwollende Allmächtigkeit.
Das „Qui tollis“ schließt in d-Moll an, ein langsamer, inniger Teil des Gloria, mit den flehenden „miserere“- und „suscipe“-Bitten. „Der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt“ beginnt in nüchternem d-Moll, der musikalische Bogen crescendiert – und bricht plötzlich, überraschend und subito pianissimo, an der Mittelsilbe von „peccata“ ab, bzw. wird über Ges-Dur in ein tröstliches Des-Dur („Tonart des Göttlichen“) übergeführt. Eigentlich logisch, wenn wir glauben, was der Text hier sagt: die Sünden der Welt mögen wohl eine grimmige Angelegenheit sein, doch werden sie vom Erlöser weggenommen, aufgelöst in eine ferne Dur-Tonart. Und schließlich „Qui sedes“, „der Du sitzt zur Rechten des Vaters“: dieser Ort steht in glücklichem, hellem A-Dur, fern vom d-Moll unserer irdischen Lasten.
„Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris“: die endlose Weite der Herrlichkeit Gottes, des Vaters, angezeigt durch einen Unisono-Liegeton auf die Silbe „glo-„, den der Chor über 5 Takte hinweg unverändert hält. In das anschließende Schweigen des Orchesters leitet der Chor nun die Gloria-Fuge ein. Mit diesem kontrapunktischen Meisterwerk aus einem bemerkenswerten Fugenthema, das mit großen, ungewöhnlichen Intervallsprüngen beginnt, schließt den Gloria-Satz im „Amen“-Jubel ab.
Credo
Im flotten alla-breve C-Dur beginnt das Credo zunächst recht konventionell und demonstriert etwas, das man in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts noch haben durfte: die Freude am Glauben. Das läuft so bis zum „Schöpfer des Himmels und der Erde“ und der Chor erläutert im Piano „visibilium omnium“ und – noch eine Stufe leiser, einen Halbton nach unten gerückt, wie ein Geheimnis, „et invisibilium“, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge also. Ähnlich kurz darauf wieder das Konstrukt „Deklaration – Glaubensgeheimnis“: „Et in unum Dominum Jesum Christum“ ist das Glaubenszeugnis, vorgetragen im C-Dur-Fortissimo, gefolgt vom tieferen Glaubensgeheimnis „et ex patre nato“, das sich bei „ante omnia saecula“, „vor aller Zeit“, in der Pianissimo-Tiefe grauer Vorzeiten verliert. Die 3 Aussagen über das Wesen Christi folgen nun in neuen Tonarten, eine breite Farbskala tut sich auf. Zunächst As-Dur: „Deum de Deo“, deklamiert der Chor, die Solisten folgen als Echo; ebenso, aber im reinen C-Dur, das „lumen de lumine“, und als Höhepunkt nun das „Deum verum de Deo vero“, 8 Takte in zutiefst überzeugter – und überzeugender – Des-Dur-Harmonie („Tonart des Göttlichen“ – s.o.). Und wieder die Weite bei Anton Bruckner (vgl. den Beitrag von Leopold Nowak in der Festschrift zur 900-Jahr-Feier von St. Florian): im „per quem omnia facta sunt“ („durch den alles geworden ist“) zieht sich, wie im Gloria, das „o-“ im Chor schier endlos über mehrere Takte. Nächstes Bekenntnis, wieder C-Dur, fortissimo: „Qui propter nos, nos homines“. Hier erlaubt Bruckner sich, wie auch schon weiter vorne bei „ante omnia, omnia saecula“ eine Wortverdoppelung, um die Aussage besonders zu unterstreichen. „Descendit“, heißt es nun in As – und von dort steigt er einen weiten Weg hinab, zur Erde, g-Moll. – Doch so groß kann die Entfernung zwischen Himmel und Erde aus Bruckners Sicht letztlich nicht sein, denn G ist der nächstgelegene Ton, gleich unter dem As.
Die Stimmung wechselt nun total von der munteren Glaubensverkündigung zu einem „Moderato misterioso“, dem „Et incarnatus“, wo der Solo-Tenor, begleitet von Solovioline und Solobratsche sowie den Holzbläsern in der „himmlischen“ Tonart E-Dur von der Menschwerdung Gottes berichtet. Solist und Chor singen im Metrum, während die Soloinstrumente synkopiert, also gegen den Taktschlag, begleiten. – Ist das Bruckners Idee von „auf krummen Zeilen gerade schreiben“? Die innige Musik führt den Solotenor durch die ausgiebig bediente Chromatik innerhalb weniger Takte in himmlisch entrückte Tonarten wie Gis-Dur (8 Kreuz) nach fis-Moll, a-Moll, As-Dur (4 b) und – durch einen enharmonischen Kunstgriff – nach Fis-Dur (6 Kreuz). Es geht hier offenbar darum, die Menschwerdung in allen Farben auszumalen. Der Chor leitet schließlich in ein schlichtes C-Dur über, bevor die Stimmung neuerlich umschlägt, ernüchtert, und mit dem „Crucifixus“ (Bruckner schreibt hier „Langsam“ vor) geradezu feierlich wird. Die Grundtonart E-Dur hat nun endgültig durch Rückung um einen Halbton nach unten (vgl. das Herabsteigen vom Himmel vorhin, von As nach g) nach Es-Dur gewechselt. Christus ist nun in einer anderen Sphäre, dem Himmel ent-rückt (E nach Es). Die Chromatik durchläuft nun b-Tonarten wie Ces-Dur, B-Dur, Des-Dur und b-Moll. Chor und Bass-Solist wiederholen nun im Dialog, wie meditativ, immer wieder die Inhalte „etiam pro nobis“, „passus“, „sub Pontio Pilato“, bis der Chor die irdische Leidensgeschichte a cappella in einer Kadenz nach Es-Dur, pianissimo, beschließt. Die Blechbläser antworten, äußerst verhalten, mit 4 Takten Begräbnismusik, dem Echo des Grablegungs-Chores. Gestorben und begraben. Mit dem Tod ist jetzt die ganze Sache vorüber. End of Story.
Tod. Schweigen. Karsamstag. Doch irgendetwas passiert hier noch. Cello und Kontrabass spielen – pizzicato – genau 2 gleiche Töne, ein Es, vor dem Doppelstrich, doch eigentlich gehört das schon zum nun folgenden Teil, Allegro. Vorzeichenwechsel, Es-Dur ist Vergangenheit, doch schreibt Bruckner keine neue Tonart vor. Was nun kommt, sieht nach C-Dur oder a-Moll (keine Vorzeichen) aus, ist es aber nicht. Etwas ganz Neues bricht hier auf. Pauke und das Pizzicato der tiefen Streicher intonieren E, also wieder eine Rückung um einen Halbton nach oben. Gott rückt in das Leben zurück, was der Mensch in den Tod gezogen hat. Bruckner sagt damit wohl, dass Gott selbst die Vorzeichen unserer so sicher geglaubten menschlichen Existenz (geboren werden, leben, sterben, aus!) ändert, die Wirklichkeit ver-rückt. Da gibt es offenbar ein Danach, mit dem niemand gerechnet hat. „Mors stupebit“, heißt es im Text des Requiems: der Tod ist wie vor den Kopf gestoßen. Die Violen beginnen mit der schnellen Achtelbewegung, die lediglich ein Gerüst aus E und der leeren Quinte H vorgibt, einen Klangraum auftut, ohne etwas über den Inhalt zu verraten. Holzbläser kommen hinzu, Bruckner schreibt „crescendo“ vor, dann „sempre crescendo“, die hohen Streicher stimmen ein, die Musik drängt stürmisch vorwärts, mehr Holz, das ganze Orchester erhebt sich zu neuem Leben. Innerhalb von 8 Takten ist etwas Ungeheuerliches, noch nie zuvor Dagewesenes passiert. Wir sind im Fortissimo, ein gewaltiger Klangraum ist entstanden, und noch immer keine Tonart. Der Stein ist weggerollt, doch ist noch niemand aus dem Grab herausgetreten. Etwas ganz Großes geschieht, sagt uns Bruckner, doch noch ist nicht enthüllt, was es ist. Jetzt erst deklamiert der Chor, worum es geht: „Et resurrexit“, er ist auferstanden! Bereits mit dem ersten Akkord des Chores mit den Blechbläsern ist klar: wir sind nun wieder in E-Dur, der himmlischen Tonart Bruckners. Wieder die Eröffnung göttlicher Weite, die Mittelsilbe „-re“ bleibt über 2 Takte hinweg liegen. „Et resurrexit“, wiederholt der Chor in den Jubel des Orchesters hinein. Niemals zuvor oder danach (vielleicht in Mahlers Auferstehungssymphonie) ist in der Kirchenmusik der zentrale Glaubensinhalt der Auferstehung so vertont worden. Man kann das alles immer noch glauben oder nicht. Aber wer dieses „et resurrexit“ aus Bruckners f-Moll-Messe miterlebt hat, hat verstanden, worum es bei der Auferstehung geht. Einen Glaubenssatz, einen Text, kann man diskutieren, bezweifeln, relativeren; aber nicht diese Musik!
Wir kommen nun in lichtes A-Dur, „et ascendit in coelum“, „er ist aufgestiegen zum Himmel“, „sitzt“, „sedet“, wiederholt der Chor, färbt das Szenario nun um nach f-Moll und geht in der Erläuterung „ad dexteram Patris“ nach d-Moll. Wir sind nun wieder allein mit unserem irdischen Drama, der Auftritt Jesu auf Erden ist definitiv vorbei. 4 Takte lang bleiben wir scheinbar ohne Beistand, bis der Chor ankündigt: „et iterum venturus est“, „er wird wiederkommen“, wiederholen die Stimmen und setzen einen musikalischen Doppelpunkt, um zu erklären, wie das geschehen soll: „cum gloria – cum gloria“, „mit Herrlichkeit“, dreifaches Forte. Herrlichkeit, für manche auch Schrecklichkeit – das erste „cum gloria“ steht in Des-Dur, das insistierend wiederholte jedoch in b-Moll, und die Posaunen zeigen die Bewegung nach unten. Der Schrecken (b-Moll) bleibt, denn nun wird erklärt, was dann passiert. Die Wiederkunft hat einen Zweck: „judicare“, „zu richten“, wiederholt der Chor immer wieder, geht aber beim zweiten gemeinsamen „judicare“ nach Des-Dur. Weltgericht, ein Durcheinander von Stimmen, immer wieder „judicare“, und zwar „judicare vivos“, man weiß nicht, wie das ausgehen wird, die Hörner bäumen sich immer wieder auf, kommen aber nicht weit, denn die aufsteigende Figur geht wieder an den Ausgangspunkt zurück, Unbestimmtheit also, keine klare Richtung; doch klingt der Chor hier nicht bedroht und in Angst und Schrecken. Er sehnt dieses Gericht Gottes geradezu herbei, wie einen Befreiungsschlag von den irdischen Bedrängnissen. Das steht ganz in der Tradition eines sehr alten Gebets der Kirche: „per iudicia tua libera nos, Domine“ – „durch Deine Urteile befreie uns, o Herr“. Gericht nicht als Bedrohung verstanden, sondern als Befreiung, Erlösung. Und noch einmal „judicare vivos“ – „et mortuos“, wird im Pianissimo angefügt: selbst die Toten werden hier Rede und Antwort stehen.
Szenenwechsel, das Weltendrama ist vorbei. Relativ nüchtern berichtet Bruckner nun in a-Moll von der Herrschaft, die kein Ende haben wird. „non erit finis“, wiederholt im Pianissimo der Bass, begleitet von den hohen Holzbläsern. Wir tauchen da in eine himmlische Sphäre, die später im Sanctus musikalisch ähnlich entfaltet wird.
Das Credo für die dritte göttliche Person („et in Spiritum Sanctum“) setzt nun folgerichtig wieder mit dem Eingangsmotiv des Satzes an. Bruckner widmet dem Heiligen Geist einen musikalischen Einschub in den Fluss des Credo, einen Hymnus der Solisten mit dem Chor, wobei diese sich keineswegs in derselben Tonart bewegen. „qui locutus est per prophetas“: mit vielen verschiedenen Stimmen hat er zu uns gesprochen, durch die Propheten. Das drückt Bruckner hier mit dieser scheinbar beziehungslosen Mehrstimmigkeit aus.
Streng und rigoros wird die Musik wieder, wenn (fast nur im Unisono) der irdische Teil des Glaubensbekenntnisses beginnt: „et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“. Beim Bekenntnis „et expecto“ setzt Bruckner wiederum den „et resurrexit“-Jubel von vorher ein, denn erwartet wird „resurrectionem“, und zwar „mortuorum, was durch ein Pianissimo ritardando des nur von der Pauke begleiteten Chores und den Blechbläsern illustriert wird: die Toten in ihren Gräbern.
In den letzten Teil des Credo, C-Dur, „et vitam venturi saeculi“ fallen immer wieder die freudig zustimmenden „credo, credo“-Rufe des Chores ein. Auch das ewige Leben ist eine farbenreiche Angelegenheit und geht durch verschiedene Tonarten, bis der Satz schließlich mit dem gedehnten Credo-Hauptthema abschließt.
Sanctus
In eine völlig neue, vorher bereits im „non erit finis“ angedeutete Klangwelt tauchen wir mit dem „Sanctus“, F-Dur. Ganz vorsichtig, wie auf Zehenspitzen, betritt der Chor diesen Raum der Heiligkeit; zögerlich steigern sich die „Sanctus“-Rufe bis zum Ausbruch „Dominus Deus“. Doch es wäre nicht Bruckner, wenn es sich mit der Heiligkeit gar so einfache verhielte. Ganz wie bei Schubert, der den Gedanken in seinen beiden großen Messen (erstmals in Messvertonungen überhaupt) durch scharfe chromatische Kontraste bei den Sanctus-Rufen deutlich macht, liegen auch hier das Herrliche und das Schreckliche unmittelbar nebeneinander. Innerhalb des „Dominus“-Anrufs taucht Bruckner von C-Dur bei „Sabaoth“ kurz in das abgründig-finstere f-Moll ab. „Pleni sunt coeli“ – womit? Voll von „gloria“ – der Herrlichkeit Gottes. Diese wieder gegen den Textfluss weit, aber nicht unbewegt, ausgedehnt über 3 Takte. Die freudigen Hosanna-Rufe, eingeleitet vom Solo-Sopran, werden vom Chor und den anderen Solisten beantwortet und von schnellen Streicherfiguren und Fanfarenstößen der Trompeten begleitet, und enden triumphal im Fortissimo.
Benedictus
„Von Vielen zu spielen“ schreibt Bruckner als Anmerkung zur Cello-Einleitung des Benedictus-Satzes (in As-Dur), hat dabei also wohl nicht an ein Solo-Cello oder an 1 Pult (2 Spieler) gedacht. Die Solisten übernehmen nacheinander die Melodie, wobei der Bass-Solist mit einem zweiten, ernsteren „Benedictus“-Thema antwortet. Die 1. Geigen stellen ein drittes Thema, eine Auf-und-Ab-Bewegung, vor, das vom Solo-Sopran übernommen wird, der Satz wird nun immer meditativer, der Chor bedenkt den „Hochgelobten“ verhalten im Pianissimo, Des-Dur, Ges-Dur – es wird immer einsamer um den Messias. Schließlich winden sich, während alle anderen schweigen, die Violinen in einem äußerst heiklen Lauf in die lichtesten Höhen, die das Instrument zulässt. Bruckner verlangt den ersten Geigern hier philharmonische Qualität ab: 9 Takte echte Zitter-Partie in jeder Aufführung. Die Luft ist sehr dünn da oben, für den, der da kommt im Namen des Herrn. – Reprise, erneut das 1. Benedictus-Thema, diesmal im Chor, der das „in nomine Domini“ in einer Steigerung von As-Dur kurz nach C moduliert, bekräftigt. Die Gewissheit: er kommt im Namen des Herrn. Doch sofort rückt der Chor wieder nach As-Dur, der Satz wird erneut meditativ, und am Ende bricht Bruckner gar der Fluss des Metrums, dreimal. Ausdrücklich im Largo buchstabiert er hier nochmals „Benedictus“. In den wenigen Takten auf dem Weg zum „Hosanna“ ändern sich Farbe und Stimmung komplett, von As-Dur nach A.
In der Sieger-Tonart D-Dur beginnt der Solo-Sopran die Hosanna-Rufe. Der Palmsonntag hat jedoch eine Schattenseite: Jesus auf dem Weg zu Auslieferung und Kreuzigung. Der Solo-Alt wendet die Stimmung in die Todes-Tonart g-Moll, auch die Hosanna-Rufe des Chores und das Orchester werden dadurch bedrohlich. Aber noch ist Palmsonntag: der Satz schließt in freudigem F-Dur.
Agnus Dei
Meditativ und innig beginnt das „Agnus“ in f-Moll mit einer Orchestereinleitung. Den Frauenstimmen in f-Moll antworten die Herren mit einer Abwärtsbewegung nach Ges-Dur. „Miserere“, „erbarme Dich“, schlägt der Solo-Bass vor. Die Anrufung wird von den anderen Solisten aufgegriffen, gesteigert, und mündet in der Forderung des Chores im Fortissimo. Ganz ähnlich aufgebaut die zweite, jetzt schon in Es-Dur beginnende, Agnus-Anrufung. Für die dritte geht der Chor aber nicht mehr ins Piano zurück. Der flehende Charakter ist nun von einer Gewissheit ersetzt, mit wem man es hier zu tun habe. Diese dritte Agnus-Anrufung kann in Bruckners Logik (und der der Tonarten-Sprache) nur in der „göttlichen“ Tonart Des-Dur stehen. Zögerlich, fast bangend, nun die Bitte um den Frieden: „dona, dona“, wiederholt der Chor, und steigert ins Fortissimo über D („dona“) schließlich in jubelndes C-Dur („pacem“). Freilich sind hier noch nicht alle Aspekte ausgelotet. Überraschend kippt Bruckner die Tonart – und die Stimmung – wieder nach As, pianissimo, „dona nobis pacem“, geht aber sogleich wieder nach C. Was hier nach spitzfindigem Tonarten-Verfolgen klingen mag, ist aber Bruckners theologische Klangsprache: innerhalb eines einzigen Taktes kann Gott alles zum Besseren, zum Frieden wenden. Noch einmal steigern sich die „Dona“-Rufe, und Bruckner greift für den abschließenden Unisono-Ruf des Chores das „(in) gloria Dei Patris, amen“-Fugenthema vom Ende des Gloria wieder auf und stellt damit die Verbindung von der dort angerufenen Herrlichkeit Gottes mit dem nun erlangten Frieden her. Ein letztes Mal wechselt die Stimmung, wird äußerst ruhig, elegisch, fast wie eine Rückschau auf das vorher Gewesene. Mit einem letzten „Dona nobis pacem“ des Chores, F-Dur, endet der Satz selig im Pianissimo.
Ich meine, dass es Bruckner darum ging, jeden einzelnen Satz, jede Phrase, mit den ihm gegebenen musikalischen Mitteln so auszuformen, zu gestalten – ja vielleicht: zu codieren, dass Glaubensinhalte sich dem aufmerksamen Hörer anders als auf der textsprachlichen Ebene des Messordinariums erschließen können. Er war sich dieses Talentes, dieser einzigartigen Gabe im Dienst der Verkündigung, bei all der ihm nachgesagten Bescheidenheit, Schlichtheit, wohl durchaus bewusst. Über das „Te Deum“, sein theologisches opus summum, hat er ja gesagt:
„Wenn mich der liebe Gott einst zu sich ruft und fragt: ‚Wo hast du die Talente, die ich dir gegeben habe?‘, dann halte ich ihm die Notenrolle mit meinem Te Deum hin, und er wird mir ein gnädiger Richter sein.“
Gott wäre wohl auch schon mit der f-Moll-Messe ganz zufrieden gewesen.
(aktualisierter Beitrag aus dem Newsletter 11/2015 von Martin Filzmaier)
Anhang 2: Zur Entstehung von Bruckners Messe e-Moll
Messe Nr. 2 e-Moll für achtstimmigen gemischten Chor und Blasorchester (WAB 27).
Anton Bruckner (1824-1896) komponierte die Messe e-Moll (1866) als Auftragswerk des Bischofs Rudigier zur Einweihung der Votivkapelle des neuen Linzer Empfängnis-Domes. Da der Dom noch nicht fertiggestellt war, musste die Aufführung zur Einweihungsfeier am 29. September 1869 im Freien stattfinden. Bruckner verzichtete daher auf Orgel und Streicher und setzte stattdessen Blasinstrumente ein. In Erwartung der Uraufführung seiner schwierigen Messe musste sich Bruckner mit vorprogrammierten Unzulänglichkeiten abfinden. Der bis zu achtstimmige Chorpart beanspruchte einen entsprechend voluminösen Klangkörper: Drei Chöre – „Frohsinn“, „Sängerbund“ und „Musikverein“ – vereinten sich zu einem großen Klangkörper von etwa 400 Sängern. Die Blaskapelle des Infanterieregiments Nr. 14 übernahm die Harmoniebegleitung. Die Einstudierung der e-Moll-Messe erwies sich als problematisch. Schon im Frühjahr hatte man nach Wien geschrieben und Bruckner wissen lassen, ,,wenn die Messe nicht jetzt schon mit den Musikvereinsschülern studiert wird, kann es nicht mehr geschehen und sie können selbe nicht mehr erlernen später, denn sie ist schwer.“ Bruckner eilte deshalb schon Ende Juli nach Linz, um die weiteren Proben persönlich zu leiten. Es sollten deren 28 werden! Die Proben fanden im Salon des Hotels Stadt Frankfurt [Probenlokal des Frohsinn] statt. Bruckner dirigierte schweißtriefend in Hemdsärmeln, ängstlich beschwor er die Mitwirkenden auszuhalten. Den Damen war er als Dirigent sehr angenehm, den Herren aber zu peinlich. Bei einer Pianissimo-Stelle schwieg nach erstmaligem Abklopfen fast der ganze Chor. Dann erst war’s ihm leise genug. „Ah, jetzt war‘s schön!“, rief er ganz entzückt. Er erzählte, dass das Werk in der Hofkapelle in Wien nach drei Proben zurückgelegt worden war. „Sie hab’n ’s net mög’n, weil’s ihna z’ schwer war.“
Die e-Moll-Messe ist die zweite der drei großen Messen, die er in d-Moll, e-Moll und f-Moll zwischen 1864 und 1868 verfasste und die zu seinen ersten großen und wichtigen Werken zählen. Beeinflusst durch den Cäcilianismus, der eine Wiederbelebung der verschütteten Vokalmusik der katholischen Kirche anstrebte, fügt er dieser Messe, die in ihrem Ausdruck stark an die altkirchliche Musiktradition anknüpft, nur ein kleines Blasorchester bei. In ihrer zeitweise schlichten, zeitweise monumentalen Klangsprache spricht sie nicht nur den religiösen, sondern gerade auch den säkularen Menschen des 21. Jahrhunderts an.
Bruckner unterzog die e-Moll-Messe, wie so viele andere seiner Werke ebenfalls, mehreren Revisionen, von denen sich die – vielfach „geglättete“ – zweite Fassung von 1882 in der Aufführungstradition durchgesetzt hat. Sie gilt als eine der größten Herausforderungen der klassisch-romantischen Chorliteratur und gehört zu jenen Messkompositionen, die trotz ihrer außerordentlichen Schönheit, doch wegen ihrer außerordentlichen Schwierigkeit kaum irgendwo in der Liturgie der Messfeier zur Aufführung gelangen.
Anhang 3: Zur Musik in Bruckners Messe e-Moll
Die e-moll-Messe fußt stark auf altkirchlicher Musiktradition. Die Thematik beruht auf den Intonationen des Gregorianischen Gesangs, die häufige Verwendung der Kirchentonarten, ostinater Bässe zeigt deutlich die starken Bindungen zur Liturgie, wie sie Meister der A-cappella-Zeit vertraten. Das Orchester verzichtet auf die Streicher, meist werden nur wenige Bläserstimmen zur Begleitung herangezogen oder fallen auch ganz fort.
So ist das Kyrie fast durchweg a- cappella gehalten, als klangliche Unterstützung treten lediglich in den leuchtenden Fortissimo-Stellen Hörner und Posaunen hinzu. Kyrie, Sanctus sowie das abschließende Agnus Dei sind auf achtstimmigen Chor gestellt, Solisten sind in der e- moll- Messe nicht vorgesehen.
Geheimnisvoll entrückt setzt das Kyrie eleison (Herr, erbarme Dich) in den Frauenstimmen ein; stufenartig, orgelmäßig steigert es sich schnell zum Forte und Fortissimo, wobei erstmalig die Hörnerstützen einsetzen. Die Männerstimmen wiederholen das Kyrie und leiten zum Christe eleison (Christ, erbarme Dich) über, das zart figurierend wiederum zuerst vom Frauenchor vorgetragen, gleich darauf von allen Stimmen aufgegriffen, zu gewaltiger Steigerung geführt wird. Das abschließende Kyrie verhallt in völliger Entrückung a cappella.
Kraftvoll in der Deklamation sind die beiden dramatischen Hauptsätze Gloria und Credo gehalten. Piano im Kirchenton beginnen unisono die Frauenstimmen das Gloria „et in terra pax“ (und Friede auf Erden), um gleich darauf mit dem „Laudamus te“ (Wir loben Dich) in strahlendes Fortissimo auszubrechen. Den Mittelteil beherrscht das innig zarte „Qui tollis peccata mundi“ Der Du trägst die Sünden der Welt“). Mit dem „Quoniam tu solus sanctus“ (Denn Du allein bist heilig) wird das Anfangsthema wieder aufgegriffen, ist somit die Reprise erreicht. Den großen Abschluss des Satzes bildet eine kunstvolle Fuge über das Amen, zuerst mit zwei Themen angesetzt; im weiteren Verlauf wird aber das Gegenthema fallengelassen, das chromatische Hauptthema durch Engführung und Umkehrung in seiner Bedeutung gesteigert bis zu dem hymnisch-homophonen Höhepunkt.
Das Credo ist noch überzeugter auf den Kirchenton gestellt. Das eintaktige Thema wird jeweils von den Bläsern, ebenfalls unisono, wiederholt, wodurch der ostinate Charakter des Satzes eindrucksvoll unterstrichen wird. Der ostinate Rhythmus, der mit dem ersten Takt des Credo einsetzt, beherrscht vollkommen den Hauptteil sowie den Wiederholungsteil, der mit den Worten „et in Spiritum sanctum“ (und an den Heiligen Geist) die Anfangsstimmung wieder aufgreift. Der Mittelteil bringt zunächst a cappella im geheimnisvollen Adagio das „et incarnatus est de Spiritu sancto“ (und empfangen vom Heiligen Geist) bis zum verhauchten „sepultus est“ (begraben ist), dem das strahlende Allegro des „et resurrexit“ (und auferstanden) folgt. Der Höhepunkt des Mittelteils wird mit dem leidenschaftlichen Unisono des „iudicare“ (zu richten) erreicht, das wie in machtvollen Hammerschlägen erdröhnt.
Dem strahlenden Glanz des Sanctus ist die stille Gläubigkeit des Benedictus gegenübergestellt.
Ergreifend schön sind die unisono Choreinsätze im Agnus Dei (Lamm Gottes), denen jeweils ein Thema in den Holzbläsern beigegeben ist, das wie eine flehende Gebärde emporstrebt. Nach dem verzweifelten Aufschrei „miserere nobis“ (erbarme Dich unser) verklingt die Messe mit dem Gebet um Frieden „dona nobis pacem“, das die Anfangsstimmung des Kyrie, auch in thematischen Wendungen, wieder aufgreift.
(Quelle: anton-bruckner.heimat.eu/e-moll-messe.htm)
Anhang 4: Ein Besuch der Jesuitenkirche bei Bruckners Messe e-Moll
Bruckner Em Mass: Chorvereinigung St Augustin – Vienna 16/11/08 (in English)
An enthusiasm for the E minor Mass is a sign of such obvious good character, I have often thought it should be officially recognised as an admissible defence in a court of law. Like the finest malt whisky, what the E minor Mass contains is pure and unadulterated, concentrated essence of Bruckner – which, like many a fine malt, can be an acquired taste, but one which more than repays the effort. This is one of those remarkable early works (the roughly contemporary Nullte being another) which manages, within its modest dimensions, to seem to span not only the entire range of Bruckner’s output, but whole centuries of musical development besides. Just one of its short sections can take you effortlessly from the 16th century polyphony of Palestrina’s Missa Brevis through to the startling chromaticism of Stravinsky’s 1948 Mass and beyond – and on the way, beguile you with such pleasing and complex harmonies that the whole process comes to seem entirely natural, if not inevitable.
The E minor Mass is fortunate in having attracted enthusiasts also when it comes to recordings, as a result of which there are none I know that are really bad, and most that are readily available are excellent. My personal favourite is Herreweghe, for the power and the clarity, but Rilling, Rögner, Creed, Best and Layton come to mind as equally recommendable – as is Jochum’s classic account, if you don’t mind the somewhat more stately tempos.
Opportunities to hear the work performed live, however, tend to be limited. Unlike the larger-scale D minor and F minor Masses, which find a ready place on the concert platform, the E minor was commissioned originally for unaccompanied choir, whose eight vocal parts Bruckner augmented with a small band of wind instruments. The end result is every bit as demanding of its performers, if not more so, requiring a first-class ensemble to do it justice. It can occasionally be heard in recital – but far and away the best context in which to hear it is as intended, as part of the Catholic liturgy, its six short sections serving to frame and punctuate an hour and more’s act of worship.
Which is why, on a bracing Sunday morning in November, we wedged ourselves into a front pew in the packed Jesuitenkirche. If you are going to hear a sung mass – not just the E minor, but any mass – presented properly in a liturgical setting, then this is one of the best places to come for it. The Chorvereinigung St Augustin – not to be confused with the choir of the Augustinerkirche in the Hofburg Palace (from which, I am told, they split some years ago amid rumours of intrigue) – have a longstanding reputation in the repertoire of sung masses which would be exceptional for any group, let alone one entirely composed of amateurs and supported only by voluntary contributions. Week after week they turn in first class performances of one demanding work after another. Last week it was the Haydn Nicolaimesse, next it will be Michael Haydn’s Missa in tempora Adventus et Quadragesimae, then Schubert, Mozart, Hassler. But today – and one of the reasons for being in Vienna this week – the Bruckner E minor.
This is one of those works for which, within certain broad limits, timings do not tell much of a story, and all you can readily deduce from the figures above is that the performance was neither exceptionally rapid nor excessively slow. One slightly unusual feature was a more measured treatment of the Agnus Dei, which personally I found welcome, as creating an even symmetry with the opening Kyrie. Also notable was the delivery of the plainchant openings to the Gloria and Credo, which usually are given either to a single cantor or else omitted entirely: here (as on e.g. the Gillesberger disk) they were sung in unison by the whole tenor section, which also works well. For the rest, this was a wholly admirable – exemplary, in fact – performance, with superb dynamics, control and clarity, and overall a level of vocal accomplishment surpassing even that on the choir’s 1996 concert recording. The direction by Andreas Pixner showed a thorough comprehension of the work and expertise in deploying his forces.
Imperfections were few, and matters of fine detail at most. This Mass imposes similar demands on the choir – particularly the alto and soprano sections – as the horns in the 4th Symphony: the requirement, from a standing start, unaccompanied, to hit a note – clearly – and hold it, shape it, sustain it, modulate it – then do it again – and again. This requires much practice and total confidence, and it is unrealistic to expect an amateur ensemble, that has had at most a few hours of rehearsal since its last outing in a different work, to attain the last degree of perfection in this. Once or twice a slight hesitation was (just about) detectable in the initial attack – but there was no wavering in the sustain, which time after time sent the vocal lines soaring in the resonant acoustic.
In the same way, any departures from the ideal in the otherwise flawless instrumental playing amounted to no more than nuances of interpretation. The sinuous oboe line starting after Qui tollis peccata mundi in the Gloria, for example, can be more affecting when given a more liquid articulation, and likewise the brass notes at et iterum venturus est cum gloria in the Credo can use a crisper attack to shape a kind of rounded-off staccato. On this occasion, in both cases, the execution was more even and uninflected – and generally you could say that, in places, the range of expression was slightly more muted than it can be. Better too little than too much, however – and it should also be pointed out that the instrumentalists were playing, and the choir singing, in their overcoats, due to the usual practice of leaving the church doors open to the University Square: the penetrating draught that blows through in consequence was quite enough to chill this listener, to say nothing of its likely effect on the players.
By any rational measure, then, this was a great performance of a seminal Bruckner work. And gratifying, too, in the way that – as is usual in the Jesuitenkirche – the music was not just grafted on to the service but made part of its fabric: for as long as it lasted, all who were present dwelled within a world created by Bruckner’s music. Indeed the whole service was soaked in Bruckner – the collection was accompanied by the motet Christus factus est – and even the homily, based on the Parable of the Talents, drew on Bruckner’s life story for illustration: his humble beginnings – his persistence despite setbacks – his troubles with Hanslick – even an account of the Brahms/Wagner divide. That’s something else you get in the Jesuitenkirche: a whole different class of sermon. It may not have the austere grandeur of the Augustinerkirche, and its domes and cupolas may be no more than cleverly framed trompe l’oeuil paint effects, but it is still a beautiful original Baroque building, with a lively and clear acoustic, where all year round, except for a few weeks in mid-summer, you can hear singing that’s the equal of anything to be found in Vienna.
(Grafik: Schattenbild „Brucker an der Orgel“ v. Dr. Otto Böhler, veröffentlicht Wien, 1914)