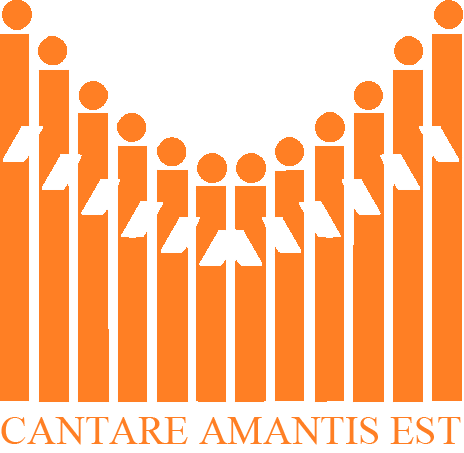NEWSLETTER FEBRUAR 2019
Liebe Freunde der Kirchenmusik!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Inzwischen ist unser neues Programm für das 1. Halbjahr 2019 erschienen, und ich lade Sie herzlich ein, die Gottesdienste in der Jesuitenkirche mit den wundervollen Werken der Wiener Kirchenmusik mitzufeiern. Das Programm ist abwechslungsreich gestaltet und bietet einige Höhepunkte: Sie hören u.a. Bruckner f-Moll, Dvořáks Messe in D-Dur, Puccinis Messa di Gloria, und zum Saisonfinale Schuberts Messe in Es, um nur einige hervorzuheben. Bemerkenswert ist die Wiederaufnahme der Messe in C-Dur von Schubert am 3. März, welche 18 Jahre nicht mehr von uns gesungen wurde. Damit ist unser Schubert-Repertoire wieder komplett!
Als Abendkonzert bringen wir am 14. Mai 2019 ein Programm mit Werken von Mozart zur Aufführung: Exsultate, jubilate KV 165, Vesperae solennes de Dominica KV 321, sowie zwei Kirchensonaten (KV 336 und 328) für Orgel und Orchester. Karten gibt es im Vorverkauf online zu bestellen (Kat. A: € 35,- und Kat. B: € 30,- )! Sie können auch per e-mail bestellen unter bestellung(at)chorvereinigung-augustin.com oder per Telefon unter +43 677-624 302 84.
Im Februar hören Sie zunächst die „Theresienmesse“ von Haydn, dann die Messe in G-Dur von Schubert, sowie die „Kleine Credomesse“ von Mozart. Die Auswahl der Messen in der kalten Jahreszeit ist gar nicht so unproblematisch, denn es muss genau auf die Besetzung geachtet werden. Während die Streicher die Stimmung relativ einfach anpassen können, vertragen Instrumente wie die Orgel und die Bläser die Kälte gar nicht gut, daher werden öfter Messen ohne Blasinstrumente ausgewählt.
Hartwig Frankl, Obmann
Sonntag, 3. Februar 2019: Joseph Haydn – „Mariazellermesse“ (1782)
Joseph Haydn (1732-1809) hat als alter Mann einmal sinngemäß gesagt, dass er nur solche Werke komponiert habe, die bei ihm in Auftrag gegeben wurden, in weiterem Sinn heißt das, nur solche Werke, für die er einen konkreten Aufführungsanlass gesehen hat.
Das heißt, dass wir – wie sein ganzes Schaffen – auch die kirchenmusikalischen Werke Haydns in einem ganz konkreten Zusammenhang mit äußeren Rahmenbedingungen für ihre Entstehung sehen müssen. Diese Rahmenbedingungen sind bei der Kirchenmusik für den Komponisten noch viel strenger und bestimmender als bei anderen musikalischen Gattungen gewesen. In der Kirchenmusik bestanden liturgische Reglementierungen, die für den Komponisten und seine Arbeit bindend waren, weil die Musik damals nicht Begleitung und Ausschmückung der Liturgie war, sondern eine allgemein verständliche Ausdrucksform dieser Liturgie.
So bestimmte der liturgische Rang des Festes oder auch nur des Gottesdienstes die Besetzung sowie ferner Charakter, Länge und Ausführung der Vertonung. Blättert man in alten Inventarbüchern von Kirchenmusik-Archiven, so sieht man, dass dort die Werke nicht nach Komponisten geordnet sind, sondern nach dem Grad ihrer Feierlichkeit.
Der Komponist hatte ferner auf landesfürstliche Vorschriften zur Kirchenmusik Rücksicht zu nehmen. Das muss für Haydns Zeit und die damalige Situation in den habsburgischen Ländern etwas näher erklärt werden. In dieser Zeit des Staatskirchentums bzw. Josephinismus hatte die Kirche einen ungeheuer wichtigen Platz im öffentlichen Leben, aber eine sehr geringe Selbständigkeit. Selbst päpstliche Verordnungen, die nur innerkirchliche Belange betrafen, durften nur dann kundgemacht werden, wenn dies vom Landesfürsten bewilligt wurde. So hat z.B. Papst Benedikt XIV. in einer Bulle vom 19. Februar 1749 für die Kirchenmusik neben den Singstimmen nur Streichinstrumente und die Orgel gestattet, die Pauken und alle sonstigen Instrumente verboten. Die österreichische Landesfürstin Maria Theresia hat sich zu dieser Bulle bis 1753 überhaupt nicht geäußert; daher wurde sie in den österreichischen Ländern auch nicht bekannt gemacht und sie brauchte daher auch nicht befolgt werden. Am 24. Dezember 1753 gestattete Maria Theresia zu verkünden, dass sie Trompeten und Pauken für kriegerische Instrumente halte und sie daher in der Kirchenmusik verbiete. Alle anderen Instrumente blieben erlaubt. Aber auch das Verbot der Trompeten und Pauken hielt nicht lange. Als am 2. Juni 1754 in Wien die Taufzeremonie für einen Erzherzog stattfand, wurde mit landesfürstlicher Bewilligung eine Ausnahme von diesem Verbot gemacht und mit Beginn des Jahres 1755 wurden Trompeten und Pauken allgemein in den Kirchen wieder verwendet. So viel oder so wenig war damals eine päpstliche Bulle wert. Eine ganz starke, einschränkende Einflussnahme des Papstes auf die Kirchenmusik hatte somit in den österreichischen Ländern praktisch keinen wirklichen Einfluss auf die Kirchenmusik.
Rund 30 Jahre später hat hingegen Kaiser Joseph II. in landesfürstlicher Funktion eine neue Gottesdienstordnung für Wien und Niederösterreich erlassen, in der er genau reglementierte, in welcher Kirche zu welchem Anlass welche Art von Kirchenmusik aufgeführt werden darf. Diese neue Gottesdienstordnung, die am Ostersonntag 1783 in Kraft trat, bedeutete in der Praxis eine Einschränkung, und für viele Kirchenmusiker, die nun weniger Dienste zu leisten hatten, einen Einkommensverlust und für manche auch die Arbeitslosigkeit.
Joseph Haydn hat zwischen 1782 und 1796 keine Messen komponiert. Der Grund lag in anderen landesfürstlichen Verordnungen, die auf den Kirchenmusik-Komponisten Haydn ihre Auswirkungen hatten. Der Prunk und die große Anzahl liturgischer Feierlichkeiten wurden in der Barockzeit zu einem guten Teil von Bruderschaften finanziert. Das waren kirchliche Laienorganisationen, die meistens soziale Aufgaben erfüllten und das Hauptfest der Bruderschaft mit besonders festlichen Gottesdiensten begingen. 1783 hatte Joseph II. alle Bruderschaften aufgelöst; ihr Vermögen wurde eingezogen und einem zentralen Armeninstitut zugewiesen. Wir wissen, dass diese Bruderschaften laufend Kompositionsaufträge für große kirchenmusikalischen Werke erteilt haben. Mit der Auflösung sind fast alle schriftlichen Unterlagen dazu verloren gegangen. Haydn hat mindestens zwei große Messen für solche Bruderschaften geschrieben: die Missa Cellensis (oder sog. Cäcilienmesse) Hob. XXII:05 und die Mariazellermesse Hob. XXII:08. Derartige Auftraggeber gab es für den reifen Haydn nicht mehr.
(In Auszügen zitiert aus: Otto Biba „Die Kirchenmusik von Joseph Haydn“)
Die „Mariazeller Messe“ von 1782 ist die letzte der frühen Messen Joseph Haydns. Die Messe, Auftragswerk für den Offizier Anton Liebe von Kreutzner, einen Freund Joseph Haydns, wurde als „Dankesopfer“ für die Wallfahrtskirche von Mariazell komponiert. Im Benedictus greift Haydn auf eine Arie aus seiner Oper „Il mondo della luna“ zurück. Die „Mariazeller Messe“ zählt aufgrund ihrer Volkstümlichkeit seit jeher zu den beliebtesten Werken Joseph Haydns überhaupt. Im Vergleich zu den späten Messen ist ihr Aufbau noch sehr traditionell: Fugen am Ende von Gloria, Credo und Agnus Dei, Solopassagen im Gloria und Credo und ein solistisches Benedictus. Allerdings baut Haydn auch ganz neue Dinge wie beispielsweise eine langsame sinfonische Introduktion am Anfang des Kyrie ein. Die Fugen sind sehr rhythmisch und stark synkopiert, die Solopassagen sind dagegen sehr theatralisch. Die Mariazeller Messe ist ein Bindeglied zwischen den frühen und späten Messen Haydns.
Als Solisten hören Sie: Cornelia Horak, Martina Steffl, Stephen Chaundy und Martin Achrainer.
Zum Offertorium singt der Chor „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven.
Sonntag, 10. Februar 2019: Franz Schubert – Messe in G-Dur (1815)
Laut Eintrag im Partitur-Autograph komponierte der gerade 18-jährige Schubert die Messe in weniger als einer Woche, vom 2. bis 7. März 1815. Da er dafür die Arbeit an seiner 2. Sinfonie unterbrach, darf angenommen werden, dass Schubert für die Messe einen Kompositionsauftrag erhalten hatte. In der Erstfassung war für das Orchester nur eine am Wiener Kirchentrio (2 Violinen und Basso continuo, hier erweitert um die Bratsche) orientierte kleine Besetzung vorgesehen. Vermutlich wurde das Werk in dieser Form erstmals 1815 unter Schuberts eigener Leitung in der Lichtentaler Pfarrkirche aufgeführt.
Zu einem nicht genau bestimmten späteren Zeitpunkt erweiterte Schubert die Besetzung des Werks um Trompeten und Pauken. Da Eusebius Mandyczewski, der Herausgeber des Werks, im Rahmen der alten Schubert-Gesamtausgabe (1887) diese Erweiterungen für unecht hielt, nahm er nur die Erstfassung in die Edition auf, was für die kommenden Jahrzehnte für die Rezeption der Messe bestimmend blieb. Erst in den 1980er-Jahren wurde der originale Stimmensatz von der Hand Franz Schuberts mit den instrumentalen Erweiterungen in Klosterneuburg wieder aufgefunden, wo am 11. Juli 1841 die erste nachweisbare Aufführung dieser Fassung stattgefunden hatte.
Der Erstdruck der Messe erfolgte 1846, allerdings fälschlicherweise unter dem Namen des früheren Prager Domkapellmeisters Robert Führer, der kurz zuvor seine Stelle wegen Betrugs verloren hatte und später wegen diverser Vergehen im Gefängnis landete. Schuberts Bruder Ferdinand forderte daraufhin 1847 in einem Zeitungsartikel die Richtigstellung, die bei der nächsten Auflage des Drucks erfolgte. Ferdinand Schubert erweiterte 1847 seinerseits die Besetzung der Messe nochmals um Oboen (oder Klarinetten) und Fagotte.
Die Messe ist überwiegend homophon und liedhaft gesetzt und somit auf die Möglichkeiten einer kleineren Kirchengemeinde hin ausgerichtet. Nur das Benedictus ist als dreistimmiger Kanon angelegt, und die Osanna-Abschnitte von Sanctus und Benedictus sind als Fugati komponiert.
Wie in allen seinen lateinischen Messvertonungen lässt Schubert im Credo den Satz „Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam“ (deutsch: „[Ich glaube an] die eine heilige katholische und apostolische Kirche“) aus, sowie in diesem Werk auch den Satz „Et expecto resurrectionem mortuorum“ (deutsch: „Ich erwarte die Auferstehung der Toten“), und gibt damit seinen ganz persönlichen Vorbehalten gegenüber bestimmten zentralen christlichen Glaubenssätzen Ausdruck.
Die G-Dur-Messe gehört heute zu den am meisten aufgeführten kirchenmusikalischen Werken Franz Schuberts.
Als Solisten wirken mit: Cornelia Horak, Franz Gürtelschmied und Klemens Sander.
Zum Offertorium singt der Chor die Motette „Lobet den Herren“ von Michael Praetorius, (eigentlich Michael Schultheiß, geb. 15. Februar 1571 in Creuzburg bei Eisenach; gest. 15. Februar 1621 in Wolfenbüttel; deutscher Komponist, Organist, Hofkapellmeister und Gelehrter im Übergang von der Renaissance- zur Barockzeit).
Sonntag, 24. Februar 2019: W.A.Mozart – „Kleine Credomesse“ (1774)
Mozarts längste Missa brevis in F-Dur KV 192, die deutlich den Umfang dieser Form sprengt, ist datiert auf den 24. Juni 1774. Sie wird auch als „Kleine Credomesse“ bezeichnet. Das Kyrie beginnt mit einem Orchestersatz. Die formal instrumentale Anlage der Messe ist mit der Gewichtigkeit der Vokalstimmen ausbalanciert. Das Gloria und Credo weisen Ritornellform auf. Das im Credo verwendete Motiv ist möglicherweise aus Fux‘ „Gradus ad parnassum“ übernommen und findet auch im Finale der Jupiter-Sinfonie KV 551 Verwendung.
Die Missa brevis komponierte Mozart für den Salzburger Dom, höchstwahrscheinlich für einen ganz normalen Sonntag. Der Chor wird nur von Streichern begleitet, die Aufgaben der Solisten sind auf kleinere Ensemble-Einwürfe zurückgedrängt. Mozart scheint die formalen Beschränkungen, die ihm auferlegt waren, als Aufgabe betrachtet zu haben, zu möglichst kreativen und interessanten Ergebnissen zu kommen. In der F-Dur-Messe ist die kontrapunktische Durchdringung besonders auffällig und reichhaltig. Für ausgedehnte Fugen war kein Platz, dennoch bringt er drei Fugati (Gloria- und Credo-Schluss sowie Osanna) unter. Von besonderer Machart ist das Credo, das durchgehend auf dem berühmten Vier-Ton-Motiv basiert, das Mozart schon in seiner ersten Sinfonie, aber auch in seiner großen Credo-Messe von 1776 und noch in seiner letzten Sinfonie, der Jupiter-Sinfonie, verwendete. Es durchzieht den ganzen Satz und ist besonders bei den immer wieder wiederholten „Credo“-Einwürfen, die der Messe den Beinamen „Kleine Credo-Messe“ verliehen haben, eingesetzt.
Die Solisten sind Aiko Sakurai, Katrin Auzinger, Gernot Heinrich und Günter Haumer.
Der Chor singt zum Offertorium die Motette „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ (Der 100. Psalm) von Mendelssohn-Bartholdy.
Sonntag, 3. März 2019: Franz Schubert – Messe in C-Dur (1816)
Messe Nr. 4 in C-Dur D 452 für Soli, Chor und Orchester von Franz Schubert (1796-1828) aus 1816.
Die Uraufführung der Messe dürfte Ende 1816 in der Lichtentaler Pfarrkirche stattgefunden, und dabei Schuberts Jugendliebe Therese Grob das Sopransolo gesungen haben.
Die C-Dur-Messe ist Schuberts einzige Messe, die zu seinen Lebzeiten – im Jahre 1825 und also 9 Jahre nach ihrer Komposition – auch im Druck erschien. Anlass dazu gab offenbar eine Aufführung in St. Ulrich in Wien am 8. September 1825, über die in der Dresdner Abend-Zeitung zu lesen war: „In der Pfarrkirche zu St. Ulrich am sogenannten Platzl ist eine neue Missa solemnis unsers beliebten Lieder-Componisten Schubert zum Feste Maria Geburt aufgeführt worden und hat den Beweis geliefert, daß der junge Mann auch im strengen Kirchensatze große Kenntnisse besitze. Gehalt und Wirkung sind bedeutend.“
Widmungsträger ist Michael Holzer, jener Regens chori, der Schuberts erste Messe in F anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jahrigen Jubiläum der Lichtenthaler Kirche aufgeführt hatte.
Der zeitliche Abstand, aber auch der offenbar repräsentativere Raum von St. Ulrich – diese Kirche gehörte zur Stadt Wien, die Lichtenthaler war Vorstadtkirche – dürften die Varianten in der Besetzung bedingt haben. Schubert notierte seine Messe nämlich zuerst für das sogenannte Kirchentrio, also 2 Violinen, Orgel und Vokalstimmen. In das Autograph trug er später Stimmen von Trompeten und Pauken ein, was deutlich einen Nachtrag darstellt. Die handschriftliche Abschrift enthält darüber hinaus auch Oboen- und Klarinettenstimmen. Und man kann annehmen, dass diese Ergänzung in einem getrennten Schritt, womöglich zur Aufführung 1825, entstand.
Wie die C-Dur-Messe den äußeren Maßen nach eine Brevis-Komposition darstellt, so ist sie auch in der satztechnischen Faktur einfach gehalten. Hier lehnt sich Schubert noch selbstverständlich an tradierte Motive – etwa die Skalen zu Beginn des Gloria – und Gestaltungsweisen an – etwa die hohen Lagen für „laudamus te“, die intime Haltung des „Et incarnatus est“. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch Eigenes wagte, wenn er das Kyrie z.B. im Piano beginnen lässt. Vor allem aber ist seine eigene Haltung in den Abweichungen vom offiziellen Messtext greifbar. Dass Schubert den Messtext und insbesondere den Text des Credo niemals vollständig vertonte – also immer das Bekenntnis zur Einheit der katholischen Kirche überging und bis auf eine Ausnahme (F-Dur-Messe) das Auferstehungsdogma auf eine seltsam falsche Wortfolge verkürzte -, ist bekannt und vielfach zu erklären versucht worden. Eine nur ihm ganz allein und ihm ganz individuell eigene Distanz zur (katholischen) Kirche und zum Auferstehungsglauben wird man Schubert darum aber wohl kaum begründet nachweisen können. Vielmehr scheint er zeit seines Lebens ein überzeugter Anhänger der katholischen Aufklärungsbewegung gewesen zu sein, die Ende des 18. Jahrhunderts eingesetzt hatte – mit der Schubert also groß geworden war – und auf die um 1820 eine deutliche Gegenreaktion einsetzte. Ganz im Sinne dieser allgemeinen kritischen Haltung insbesondere den Offenbarungsinhalten gegenüber übergeht Schubert derartige Stellen. Ebenso unantastbar ist daher auch die exakte Wortfolge, wie mehrfache Umstellungen des Textes im Gloria der C-Dur-Messe zeigen. Im Credo hat Schubert außerdem die zu seiner Zeit besonders problematischen Aussagen „Genitum, non factum“ und „ex Maria Virgine“ ausgelassen. Umgekehrt scheint Schubert dann aber auch, wo es inhaltlich nicht problematisch war, eine Textkorrektur zugelassen oder selbst vorgenommen haben: Am Beginn des Sanctus hat er die Worte „Dominus Deus Sabaoth“ fortgelassen; in den gedruckten Stimmen erhielten die Takte 3-4 diesen Text.
Weshalb Schubert drei Jahre nach dem Druck der Messe ein neues Benedictus komponierte, ist nicht bekannt. Die Verwendung des Chores an Stelle des Solosoprans legt jedoch einen konkreten Auftrag für einen Kirchenmusikverein nahe, dem kein entsprechend gut ausgebildeter Sopran zur Verfügung stand. Schubert hat dieses Benedictus allerdings deutlich einem früheren Stadium seines kirchenmusikalischen Komponierens angepasst und hat sich mit einem Minimum an motivisch-thematischer Komplexität dabei gleichzeitig und vielleicht bewusst an den zu dieser Zeit modernen Bestrebungen der Kirchenmusik orientiert.
(Manuela Jahrmärker, aus dem Vorwort zur Stuttgarter Schubert-Ausgabe, Carus-Verlag, Juli 2000)