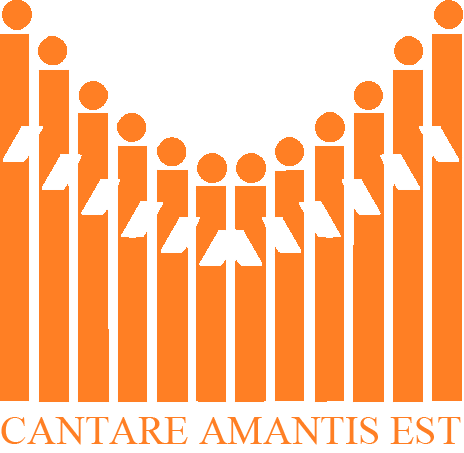Ein neues Jahr bricht über uns herein, Bedrängnis aller Orten, Krisen, Not, schrecklicher Krieg und Katastrophen. – Wenn wir davon hören, diese Zeichen sehen, sagt Jesus, sollen wir erkennen: das Ende ist nahe. Der Bundespräsident meint jedoch, wir sollten die Möglichkeit einer positiven Überraschung einräumen, Hoffnung zulassen, unsere täglichen Aufgaben mit gutem Willen und Optimismus – er meint wohl „Zuversicht“ – erledigen. Dem lässt sich schwerlich widersprechen.
Bei all dem Furchtbaren, das um uns herum geschieht, singt und musiziert sich die Chorvereinigung unverzagt durch die kommende Saison, trällert und jubiliert mit den musikalisch und theologisch einzigartigen großen Haydn-Messen, lässt den musikalischen Gastarbeiter Amadé M. aus Salzburg seinen genialen Schabernack treiben, zaubert mit der fröhlichen und glanzvollen Italianità von Puccini ein Lächeln in die Gesichter der Kirchenbesucher, und wagt sich auch wieder an Werke, die zumindest zu ihrer Entstehungszeit von vielen als schräg oder gar als unsagbar lächerlich und bedauernswert empfunden wurden – gemeint ist hier wieder eine Messe von so einem Gastarbeiter, diesmal aus dem fernen Bonn, aber dafür in C-Dur; das ist doch schon was.
Irgendwie lässt die Chorvereinigung sich nicht davon abbringen, Woche für Woche sich selber eine Freude zu machen, den Mitfeiernden in der Messe vielleicht auch, und womöglich auch noch – O.A.M.D.G. – dem lieben Gott, den viele dieser Komponisten mit ihren Werken zu verherrlichen trachteten.
Viele Umstände wären wohl geeignet, unser Bestehen auf diese wöchentlichen Zufluchtsorte aus Freude und Seligkeit zu sabotieren. So zum Beispiel, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: es wird alles teurer. Weil alles teurer wird, schnallen die Menschen die Gürtel enger und sind weniger bereit, etwas für den Luxus Kirchenmusik auszugeben. Unsere Einnahmen gehen also zurück, und gleichzeitig geben wir mehr Geld aus. – Warum? Wir sind der Meinung, dass die großartigen Berufsmusiker:innen und Solist:innen, die einem Laienchor wie uns seit Jahren und Jahrzehnten das Musizieren auf Konzertsaalniveau ermöglichen, ein deutliches Zeichen der Anerkennung verdient haben, nicht einfach nur ein bisschen Inflationsanpassung. Ihre Tarife wurden seit ewigen Zeiten nicht erhöht, und es ist ein Gebot der Fairness, dies jetzt zu tun. Kräftig. Jetzt, wo alles teurer wird, und wo unsere Einnahmen zurückgehen. Der Vorstand erkennt die Notwendigkeit dieses Schrittes an, blickt aber mit großer Besorgnis auf diese Entwicklung. Einige sehen den finanziellen Untergang heraufdämmern und befürchten das nahende Ende.
Der Obmann teilt diese Befürchtung nicht. Er ist zuversichtlich, dass ein Unternehmen wie unseres gar nicht untergehen kann, weil so etwas einfach nicht sein darf. Außerdem räumt er die Möglichkeit einer positiven Überraschung ein und fokussiert auf den bestmöglichen Ausgang (Zitat VdB). Sorgen macht er sich trotzdem, weil sich erst jetzt so richtig zeigt, wie gesegnet wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten waren: ein großer Chor mit sehr guten Sopranistinnen, Altistinnen, und sogar Tenören und Bässen. Ein erstklassiges Orchester, top-level Solist:innen. Förderung durch die gastgebenden Jesuiten, Zuspruch auf vielen Ebenen durch die Besucher:innen, also Mitfeiernden, der Hochämter. Eine der Säulen, auf denen diese Kunstinstallation ruht, ist jedoch – nicht nur – pandemiebedingt weggebrochen. Unser Chor hat sich verkleinert. Deutlich verkleinert. Ein musikalisches Unternehmen wie unseres benötigt nicht nur Qualität, sondern auch in gewissem Ausmaß Quantität, um zu funktionieren. – Warum? Nun, die enorme Arbeitsdichte, die erforderlich ist, Woche für Woche solche Werke hinter den Altar („auf die Bühne“ wäre unpassend) zu bringen, verlangt den Mitwirkenden auch enorme zeitliche Opfer ab. In einem großen Chor gibt es dabei die Möglichkeit, sich auch das eine oder andere Mal zu entschuldigen und anderen Verpflichtungen nachzugehen. – Gibt es andere Verpflichtungen? Ah ja, da war ja noch die Familie. Oder auch die Arbeit, denn nicht alle arbeiten Montag bis Freitag von 8 bis 4. Und es soll ja auch Jahreszeiten geben, zu denen viele Menschen – sogar Chorsänger:innen – krank werden; selbst ohne Pandemie. In der jetzigen Situation aber wissen die Mitwirkenden, dass ein gelegentliches Fernbleiben die Singfähigkeit des Chors gefährden kann und fühlen sich unter Druck, noch mehr Einschränkungen bei ihren anderen Obliegenheiten zu machen, weil sonst das Werkl steht. Das kann dann zu einem Punkt führen, wo jemand sagt, bei aller Liebe, so schön das auch ist – aber mir ist das jetzt zu viel. Und aufhört.
Vielleicht verstehen Sie, warum ich so ausführlich auf diese spezielle Problematik eingehe: wir brauchen einfach wieder mehr gute Sängerinnen und Sänger. Damit der Druck auf die jetzige, verkleinerte Schar, weniger wird. Damit wieder auch die (besetzungsmäßig) großen Werke, die immer unser Markenzeichen waren, wieder möglich werden.
Gibt es denn wirklich so wenige davon? Nein, nein – die sind schon vorhanden, und ich kenne auch persönlich viele, die das machen könnten; doch unser spezielles Problem ist: diejenigen, die so gut singen, dass sie sofort bei uns mitmachen könnten, werden anderswo für diese professionelle Leistung bezahlt. Unser Chorleiter hat aber die fixe Idee, professionelle Leistungen auch von unbezahlten, ehrenamtlich wirkenden Menschen einzufordern. Und das ist auch gut so! So war das bei uns immer. Hätten wir einen ähnlichen Aufwand für bezahlte Substitut:innen wie andere große Kirchenmusikeinrichtungen der Innenstadt, könnten wir in kurzer Zeit zusperren.
Ich komme zum Ende dieses flammenden Appells zum Jahresanfang. Wir sind froh und dankbar, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Aber fast noch mehr brauchen wir Sie, wenn Sie gut singen können und sich zutrauen, wenigstens auszuprobieren, ob unsere Tätigkeit für Sie passt. Auch bei Proben einmal hineinzuschnuppern ist möglich und erwünscht.
Freilich kann ich Ihnen nicht reinen Gewissens sagen, kommen Sie zu uns, jede:r kann mitmachen. Nein, so ist das nicht, und Sie können sich denken, dass der Musikalische Leiter sich die Stimme anhört (auch Notenlesenkönnen soll angeblich nicht unwesentlich sein) und schaut, ob das für uns passt. Letztlich ist es dann schon eine Auszeichnung, zur Chorvereinigung zu gehören.
Noch nicht genug Motivation, mitzusingen? – Finden Sie im 3. Absatz. Und glauben Sie mir: die Leute, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten bei uns singen, tun das bestimmt nicht, weil alles so mühsam und beschwerlich ist.
Jetzt habe ich vor lauter Flammenappell gar nichts zum Jänner-Programm gesagt. Also, um die Theresienmesse am 15. einigermaßen ausgeschlafen singen zu können, habe ich mir für die Hälfte meines Balldienstes in der Hofburg eine Vertretung engagiert, zahle also Geld, um gratis mitsingen zu können. – Verrückt, oder? Die „Missa in angustiis“ am Monatsende passt – leider – genau in die Zeit. Jänner. Bedrängnis überall. D-Moll. Großartig! Bei den ersten beiden Messen des Jahres bin ich leider nicht da. Zu „Epiphanias“, vulgo „Dreikönigsfest“, singen wir die allseits beliebte Krönungsmesse. Keine große Überraschung. Ganz bemerkenswert aber der zugehörige Kommentar eines leider anonymen Autors, den Sie gleich unterhalb meiner Zeilen finden.
Prosit Neujahr!
Ihr
Martin Filzmaier, Obmann
Freitag, 6. Jänner 2023, 10:30 Uhr: Dreikönigstag
W.A.MOZART: Missa solemnis in C-Dur – „Krönungsmesse“ KV 317 (1779)
 Mozart hat sich bisweilen über die auferlegte Kürze und das Fugenverbot für die 45-Minuten-Hochämter seines fürstlichen Dienstherrn beklagt. Aber er hat die gebotene Kürze genützt. Auch seinen weiträumigeren Messkompositionen kam die Raffung zugute: so der reich instrumentierten Missa solemnis mit Chorposaunen für die Salzburger Stiftskirche St. Peter oder der grandiosen Krönungsmesse für die Wallfahrtskirche Maria Plain.
Mozart hat sich bisweilen über die auferlegte Kürze und das Fugenverbot für die 45-Minuten-Hochämter seines fürstlichen Dienstherrn beklagt. Aber er hat die gebotene Kürze genützt. Auch seinen weiträumigeren Messkompositionen kam die Raffung zugute: so der reich instrumentierten Missa solemnis mit Chorposaunen für die Salzburger Stiftskirche St. Peter oder der grandiosen Krönungsmesse für die Wallfahrtskirche Maria Plain.
Mozarts geistliche Musik seiner Wiener Jahre, seiner neun letzten Lebensjahre – wieviel ist an ihrem spärlichen Fluss herumgeheimnist worden! Sein Zerwürfnis mit dem Salzburger Brotherrn, seine zeitweilige Entfremdung vom Vater, die Ehe mit Constanze Weber, seine Bruderschaft in einer Freimaurer-Loge und anderes mehr musste Mozarts angebliche Abkehr vom Glauben und die Abwendung von kirchlicher Musik erklären. Als ob biographische Taxonomie Fehl oder Fülle an Kompositions-„Zeugnissen“ zu erklären vermöchte! Tatsache ist, dass Mozart seine c-Moll-Messe 1782 noch zu komponieren begann, obwohl er mit einer Aufführung – einem Erlass Josephs II. zufolge, der Orchestermessen inner- und außerhalb der Kirchen verbot – zumindest in Wien nicht mehr rechnen konnte. Wahr ist ferner, dass es eine Gelöbnismesse war (zur Genesung Constanzes, zur Erstgeburt und zur Aussöhnung mit dem Vater). Und so dünnhäutig und impulsiv Mozart sein mochte, er wusste sehr wohl zu unterscheiden zwischen Glaubenslehre und Glaubensträgern. Was sonst hätte ihn veranlasst, 1791, nach Aufhebung jener Dekrete (der reformforsche Kaiser war 1790 früh verstorben) mit dem Kerzenlicht in der Hand in der Wiener Stadt die Fronleichnamsprozession zu begehen, am Stephansdom, um die Organistenstelle einzukommen und sich des anonymen Auftrags des „Requiem“ nicht zu entschlagen, obwohl ihn die „Zauberflöte“ durch anhaltende Wiederholungen eben jetzt seiner Geldsorgen zu entheben versprach?
Nicht die Weisheitslehren der „Zauberflöte“ haben die Erhabenheit des Requiems herbeigerufen, wohl aber strahlt die Wahrschau der Sequenz vom Jüngsten Gericht aus der Totenmesse gleichsam in menschlich milder Brechung auf die Musik der „Zauberflöte“ zurück. Bach und Händel, auch die Gregorianik, bildeten hier stärkere Säulen als die des Logentempels „Zur dreifach gekrönten Weisheit“. In Leipzig, auf der Bittfahrt nach Berlin im Sommer 1789, traktierte Mozart in St. Thomas die Orgel. Doles, der Kantor, meinte den alten Bach wiederzuhören; es war die gleiche Kraft des Geistes und des Glaubens, jener war es aus der Wurzelkraft sächsisch-thüringischen Luthertums, dieser aus dem Urgrund süddeutsch-österreichischer Katholizität.
Der Name „Krönungsmesse“ für die Missa in C KV 317 – die Urschrift ist am 23. März 1779 datiert – geht vermutlich auf den Anlass ihrer Entstehung zurück: Mozart komponierte sie für eine Jahresfeier der Krönung des Gnadenbildes von Maria-Plain bei Salzburg. Wie schon für acht vorangegangene Messvertonungen wählte er wiederum C-Dur als Grundtonart; doch vor allem die Instrumentalbesetzung (zum vierstimmigen Chor und einem ausgedehnt eingesetzten Solistenquartett tritt ein Orchester mit Violinen, Celli, Kontrabässen, je zwei Oboen, Hörnern und Trompeten, drei Posaunen, Kesselpauken sowie Orgelcontinuo) ist großartiger und repräsentativer als in seiner früheren Kirchenmusik. Die liturgische Bindung erforderte die kurze, konzise Anlage einer Missa brevis. Allein, Mozarts Kunstverstand und sein unfehlbarer dramatischer Sinn erfüllten auch den knappen Werkraum mit einer Vielfalt an Gedanken und tönenden Geschichten.
Zwischen die prachtvollen Tuttis des Kyrie eleison (Andante maestoso) schieben Solo-Sopran und -Tenor ein sanftes Duett (piu andante), von den beiden Oboen delikat begleitet. Das Gloria – auch hier flicht das Solistenquartett feine Partien ein – zieht vom ersten bis zum letzten Takt mit einem beschwingten Impetus (Allegro con spirito) glanzvoll vorüber. Um die Harmonien mancher Chorpassagen zu füllen und den Einklang zu steigern, sind die Gesangsstimmen zuweilen durch korrespondierende Posaunen gestützt. Durch solche Massierung gewinnt etwa der Beginn des Credos (Allegro molto) große Kraft und Herrlichkeit: dabei deklamiert der Chor durch die Worte „Credo in unum Deum“ in Unisono-Oktaven. Die Geheimnisse der Menschwerdung, des Leidens und der Auferstehung Christi werden durch expressive Modulationen und stimmungsvolle Klänge besonders inbrünstig ausgedeutet.
Das Sanctus ist, wie üblich, zweigeteilt Andante maestoso und – zum Osanna – Allegro assai). Das Benedictus (Allegretto) ist, außer zwei kurzen Osanna-Tuttis, leicht und lieblich gesetzt und wird von den vier Solisten sotto voce gesungen; es beginnt mit zehn Streichertakten, die aus einer Serenade oder einem Divertimento sich hierher verirrt zu haben scheinen. Musik voller Anmut und Grazie, die freilich in solch gottesdienstlicher Funktion doch bewegende Züge von Demut und Frömmigkeit annimmt. Das Agnus Dei (Andante sostenuto) erklingt als inniges Sopransolo. Erst beim „Dona nobis pacem“ stimmen die übrigen drei Solisten, später der ganze Chor, ein. Etwas überraschend für unser Bewusstsein – doch wohl nicht für die Gläubigen des 18. Jahrhunderts – läuft diese Schlussbitte des Ordinariums Missae in ein frisches, lebhaftes Allegro con spirito aus; das tiefempfundene Gebet um Frieden wird so in eine glanzvolle, sogar recht laute Pracht gekleidet.
(Text aus dem Cover der LP Electrola 1 C 063-28 500. Autor nicht genannt.)
Als Solisten wirken mit: Monika Riedler, Katrin Auzinger, Gernot Heinrich, Klemens Sander.
Sonntag, 8. Jänner 2023, 10:30 Uhr
Franz SCHUBERT: Deutsche Messe, D 872 (1826)
 Kein Messlied hat, neben dem von Michael Haydns Messgesang „Hier liegt vor deiner Majestät“, so weltweite Verbreitung gefunden wie Franz Schuberts sogenannte „Deutsche Messe“. Die Komposition entstand in den Jahren 1826/27 auf Wunsch des Professors für Physik am k.k. polytechnischen Institut in Wien Johann Philip Neumann (1774-1849), der auch der Textdichter war. In ihrer Originalgestalt für gemischten Chor, Harmoniemusik, Orgel und Kontrabass ad lib. erschien sie erst 1870 im Druck, und zwar bei J. P. Gotthard in Wien. Ihre weit über den deutschen Sprachraum hinausreichende Popularität verdankt sie indessen von einer im Jahre 1866 von Johann Ritter von Herbeck (Dirigent, Komponist, Hofoperndirektor) veröffentlichten und als „Original“ legitimierten Bearbeitung für unbegleiteten Männerchor. Diese Fassung – nicht aus der Feder Herbecks – erweist sich als arge Verballhornung, hat sich aber bei den Männerchören sehr rasch verbreitet und eingebürgert; spätere, nicht weniger bedenkenlose „Bearbeitungen“ folgten und führten vom so gut wie unbekannt gebliebenen Original immer weiter weg. Längst hätte das Schicksal dieser berühmten Messgesänge einer gründlichen Klarstellung bedurft. Der erste Schritt hierzu soll die Urtextausgabe nach dem Autograph der Wiener Stadtbibliothek sein, die der Verlag Doblinger in seinem hundertsten Bestandsjahr (1976) vorlegt. Er glaubt damit auch einer gewissen Verpflichtung zu entsprechen, hatte doch im Jahre 1890 der damalige Chef des Hauses, Bernhard Herzmansky sen., den Verlag Gotthard erworben und damit auch die Stichplatten des Erstdrucks. Aus naheliegenden Gründen wurde die auf Ferdinand Schubert zurückreichende, heute allgemein übliche und prägnante Bezeichnung „Deutsche Messe“ gewählt. Da der Orgelpart original von Franz Schubert stammt, kann die Messe auch mit bloßer Orgelbegleitung mit Kontrabass ad libitum aufgeführt werden, was durchaus der kirchenmusikalischen Praxis um 1830 entspräche. Es wäre auch denkbar, dass Schubert an eine Begleitung entweder durch Bläser oder Orgel allein gedacht und in seiner Partitur für beide vorgesorgt hat.
Kein Messlied hat, neben dem von Michael Haydns Messgesang „Hier liegt vor deiner Majestät“, so weltweite Verbreitung gefunden wie Franz Schuberts sogenannte „Deutsche Messe“. Die Komposition entstand in den Jahren 1826/27 auf Wunsch des Professors für Physik am k.k. polytechnischen Institut in Wien Johann Philip Neumann (1774-1849), der auch der Textdichter war. In ihrer Originalgestalt für gemischten Chor, Harmoniemusik, Orgel und Kontrabass ad lib. erschien sie erst 1870 im Druck, und zwar bei J. P. Gotthard in Wien. Ihre weit über den deutschen Sprachraum hinausreichende Popularität verdankt sie indessen von einer im Jahre 1866 von Johann Ritter von Herbeck (Dirigent, Komponist, Hofoperndirektor) veröffentlichten und als „Original“ legitimierten Bearbeitung für unbegleiteten Männerchor. Diese Fassung – nicht aus der Feder Herbecks – erweist sich als arge Verballhornung, hat sich aber bei den Männerchören sehr rasch verbreitet und eingebürgert; spätere, nicht weniger bedenkenlose „Bearbeitungen“ folgten und führten vom so gut wie unbekannt gebliebenen Original immer weiter weg. Längst hätte das Schicksal dieser berühmten Messgesänge einer gründlichen Klarstellung bedurft. Der erste Schritt hierzu soll die Urtextausgabe nach dem Autograph der Wiener Stadtbibliothek sein, die der Verlag Doblinger in seinem hundertsten Bestandsjahr (1976) vorlegt. Er glaubt damit auch einer gewissen Verpflichtung zu entsprechen, hatte doch im Jahre 1890 der damalige Chef des Hauses, Bernhard Herzmansky sen., den Verlag Gotthard erworben und damit auch die Stichplatten des Erstdrucks. Aus naheliegenden Gründen wurde die auf Ferdinand Schubert zurückreichende, heute allgemein übliche und prägnante Bezeichnung „Deutsche Messe“ gewählt. Da der Orgelpart original von Franz Schubert stammt, kann die Messe auch mit bloßer Orgelbegleitung mit Kontrabass ad libitum aufgeführt werden, was durchaus der kirchenmusikalischen Praxis um 1830 entspräche. Es wäre auch denkbar, dass Schubert an eine Begleitung entweder durch Bläser oder Orgel allein gedacht und in seiner Partitur für beide vorgesorgt hat.
Das Autograph der Messe und das Textbuch befinden sich in der Wiener Stadtbibliothek. Leider fehlt bei beiden die Titelseite. Nach dem Revisionsbericht der alten Gesamtausgabe lautete der Titel: „Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe.“
Eine öffentliche Aufführung war zu Schuberts Lebzeiten nicht möglich. Das „Censur-Protokoll“ des Erzbischöflichen Konsistoriums in Wien vermerkt am 24.10.1827: „admittuntur jedoch nicht zum öffentlichen Kirchengebrauche“. Die Freigabe erfolgte erst nach 1850. Eine erste, unvollständige Aufführung hatte jedoch unter der Leitung Ferdinand Schuberts am 8. Dezember 1846 in der Kirche St. Anna in Wien stattgefunden.
Im Vorwort der Ausgabe von 1870 wird noch bemerkt, dass die metronomische Bezeichnung nicht von Schubert, sondern von der Hand Neumanns beigefügt ist. Neumann hat nämlich laut einer Tagebuchaufzeichnung die Tempi nach einem Maelzel’schen Metronom aufgenommen und so in die Partitur eingetragen, wie sie ihm vom Komponisten angegeben wurden, als dieser einmal bei ihm zu Besuch war und die Sätze der Messe der Reihe nach vorspielte.
(Zitiert aus dem Vorwort zur Partitur von Franz Burkhard, Verlag Doblinger, Wien 1976)
Sonntag, 15. Jänner 2023, 10:30 Uhr
Joseph HAYDN „Theresienmesse“ Hob.XXII:12 (1799)
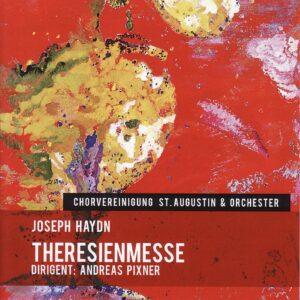 Haydn verpflichtete sich für den Namenstag der Fürstin Maria Josepha Hermenegild, der alljährlich im September mit einem Festgottesdienst in der Eisenstädter Bergkirche begangen wurde, eine feierliche Messe zu komponieren. Als erste dieser Messen entstand 1796 die Heiligmesse. Die Messe für den Namenstag 1797 schrieb Johann Nepomuk Fuchs, doch wurde „außer Konkurrenz“ am 29. September 1797 Haydns Paukenmesse, die anlässlich einer Primiz in der Wiener Piaristenkirche im Dezember 1796 von ihm geschrieben worden war, aufgeführt. 1798 komponierte er die Nelsonmesse, sodann im Jahr 1799 die Theresienmesse (Große Messe in B-Dur, Hob.XXII:12). Es folgten 1801 die Schöpfungsmesse und 1802, als letzte, die Harmoniemesse. Um die späten großen Messen in der kirchenmusikalischen Praxis besser unterscheiden zu können – stehen doch vier der Werke in B-Dur – hat jede von ihnen einen volkstümlichen Namen erhalten. Diese stammen allerdings nicht von Haydn. Die Bezeichnung „Theresienmesse“ zählt zu den weniger geglückten, da sie auf einer Ver – mischung verschiedener Tatsachen beruht. Belegt ist eine Aufführung der Messe in der Hofburgkapelle, in der die Kaiserin Marie Therese, die Gattin Franz II., die Sopranpartie sang. Diese war die Tochter von König Ferdinand IV. von Neapel und ist natürlich nicht identisch mit der berühmten Kaiserin Maria Theresia, die schon 1780 gestorben war. Marie Therese hat bei Haydns Bruder Michael im Jahr 1801 eine Messe in Auftrag gegeben, die zu Recht „Theresienmesse“ heißt (Kl 1:22). Allerdings hat auch Joseph Haydn 1799 ein Werk für den Kaiserhof, nämlich ein Te Deum (Hob:XXIIIc:2) geschrieben – offenbar alles Gründe, die im selben Jahr entstandene Messe mit der Kaiserin in Verbindung zu bringen.
Haydn verpflichtete sich für den Namenstag der Fürstin Maria Josepha Hermenegild, der alljährlich im September mit einem Festgottesdienst in der Eisenstädter Bergkirche begangen wurde, eine feierliche Messe zu komponieren. Als erste dieser Messen entstand 1796 die Heiligmesse. Die Messe für den Namenstag 1797 schrieb Johann Nepomuk Fuchs, doch wurde „außer Konkurrenz“ am 29. September 1797 Haydns Paukenmesse, die anlässlich einer Primiz in der Wiener Piaristenkirche im Dezember 1796 von ihm geschrieben worden war, aufgeführt. 1798 komponierte er die Nelsonmesse, sodann im Jahr 1799 die Theresienmesse (Große Messe in B-Dur, Hob.XXII:12). Es folgten 1801 die Schöpfungsmesse und 1802, als letzte, die Harmoniemesse. Um die späten großen Messen in der kirchenmusikalischen Praxis besser unterscheiden zu können – stehen doch vier der Werke in B-Dur – hat jede von ihnen einen volkstümlichen Namen erhalten. Diese stammen allerdings nicht von Haydn. Die Bezeichnung „Theresienmesse“ zählt zu den weniger geglückten, da sie auf einer Ver – mischung verschiedener Tatsachen beruht. Belegt ist eine Aufführung der Messe in der Hofburgkapelle, in der die Kaiserin Marie Therese, die Gattin Franz II., die Sopranpartie sang. Diese war die Tochter von König Ferdinand IV. von Neapel und ist natürlich nicht identisch mit der berühmten Kaiserin Maria Theresia, die schon 1780 gestorben war. Marie Therese hat bei Haydns Bruder Michael im Jahr 1801 eine Messe in Auftrag gegeben, die zu Recht „Theresienmesse“ heißt (Kl 1:22). Allerdings hat auch Joseph Haydn 1799 ein Werk für den Kaiserhof, nämlich ein Te Deum (Hob:XXIIIc:2) geschrieben – offenbar alles Gründe, die im selben Jahr entstandene Messe mit der Kaiserin in Verbindung zu bringen.
Haydn hat die Theresienmesse am 8. September 1799 in der Eisenstädter Bergkirche aufgeführt. Am Abend zuvor fand im Eisenstädter Schloss ein Fest zu Ehren Maria Hermenegildis statt. Ein Tagebuch notiert: „Abends um 6 Uhr war auf dem Platz türkische Musik, dann französisches Schauspiel. Zu Ende eine Decoration mit dem Bilde der Fürstin […].“ Während die Nelsonmesse (in d-moll mit drei Trompeten und obligater Orgel) archaisch-barock wirkt, erscheint die Theresienmesse hingegen – in B-Dur, was den Trompeten den scharfen Klang nimmt – kammermusikalisch. Diese besondere Stimmung kennzeichnet schon den Beginn des Kyrie, das einem Symphoniesatz mit langsamer Einleitung und zwei Themen ähnelt. Vielgestaltig ist der Mittelteil des Gloria: Zunächst setzen die Solisten mit einem verhaltenen, ruhigen Thema ein („Gratias agimus tibi“), bis Chor und Orchester sich dramatisch einmengen („Qui tollis peccata mundi“); flehentlich wirkt die Bitte der Solisten („Suscipe deprecationem nostram“). Das Credo beginnt kantig-robust wie der entsprechende Satz der Nelsonmesse. Der ruhige Mittelteil, allein den Solisten vorbehalten, fasst Menschwerdung und Kreuzestod Christi in einem einzigen stimmungsmäßig homogenen Satz zusammen. Sein kompositorisches Können zeigt Haydn, wie er im abschließenden Teil die vielen Glaubenssätze durch Aufteilung des Textes unter Chor und Solisten vertont. Überraschend freundlich das Benedictus, ein Messteil, der in Haydns übrigen Messen nicht selten bedrohlich geformt ist. Geradezu beängstigend ist der Beginn des Agnus Dei; erst mit Mitwirkung der Solisten entwickelt sich die Messe zu einem festlichen, gelösten Abschluss.
Text: Mag. Patrick Maly (aus dem Booklet zu unserer CD)
Als Solisten musizieren mit uns: Ursula Langmayr, Eva-Maria Riedl, Daniel Johannsen und Markus Volpert.
Sonntag, 29. Jänner 2023, 10:30 Uhr
Joseph HAYDN „Nelsonmesse“ Hob. XXII:11 (1798)
 Es gibt mehrere Beispiele dafür, dass Haydn Bläserstimmen zu eigenen Kirchenmusikwerken nachkomponieren hat lassen. Das konnte liturgische Gründe haben oder aufführungspraktische, wenn zur Zeit der Uraufführung am Ort bestimmte Blasinstrumente nicht zu besetzen waren. So hat Haydn z.B. für seine Paukenmesse einen Part für zwei Klarinetten ergänzend nachkomponiert. Seine sogenannte Nelsonmesse (Hob. XXII:11) wurde von Haydn nur für Streicher, 3 Trompeten, Pauken und konzertierende Orgel komponiert, weil in der esterházy‘schen Kapelle zur Zeit der Uraufführung im September 1798 keine Holzbläser zur Verfügung waren. Als eine Besetzung mit Holzbläsern wieder verfügbar war, hat Haydns Vizekapellmeister am esterházy‘schen Hof Johann Nepomuk Fuchs den konzertierenden Orgelpart für Holzbläser gesetzt und weitere Aufgaben für sie frei ergänzt. In dieser Form ist die Messe unter Haydns Namen und ohne Erwähnung von Fuchs im Druck erschienen.
Es gibt mehrere Beispiele dafür, dass Haydn Bläserstimmen zu eigenen Kirchenmusikwerken nachkomponieren hat lassen. Das konnte liturgische Gründe haben oder aufführungspraktische, wenn zur Zeit der Uraufführung am Ort bestimmte Blasinstrumente nicht zu besetzen waren. So hat Haydn z.B. für seine Paukenmesse einen Part für zwei Klarinetten ergänzend nachkomponiert. Seine sogenannte Nelsonmesse (Hob. XXII:11) wurde von Haydn nur für Streicher, 3 Trompeten, Pauken und konzertierende Orgel komponiert, weil in der esterházy‘schen Kapelle zur Zeit der Uraufführung im September 1798 keine Holzbläser zur Verfügung waren. Als eine Besetzung mit Holzbläsern wieder verfügbar war, hat Haydns Vizekapellmeister am esterházy‘schen Hof Johann Nepomuk Fuchs den konzertierenden Orgelpart für Holzbläser gesetzt und weitere Aufgaben für sie frei ergänzt. In dieser Form ist die Messe unter Haydns Namen und ohne Erwähnung von Fuchs im Druck erschienen.
Dem Komponisten in der Kirchenmusik waren wie in keiner anderen musikalischen Gattung Vorschriften von Liturgie, Tradition, Aufführungspraxis etc. vorgegeben. Doch es darf nicht der Eindruck entstehen, dass sich Haydn als Kirchenmusikkomponist überhaupt nur Zwängen zu beugen hatte, ganz im Gegenteil. In erster Linie ist dies geradezu in verblüffender Weise dort der Fall, wo Haydn bei rein äußerlicher Betrachtung diesen Vorschriften oder der Erwartungshaltung zu folgen scheint. Freilich gibt es in Haydns Kirchenmusik auch Beispiele dafür, dass er in seinen persönlichen Vorstellungen sehr weit gehen konnte – so weit, dass er mit Konventionen und Traditionen brach.
Ein Beispiel dafür kann das Benedictus der Nelsonmesse sein. Das Benedictus ist üblicherweise ein Satz mit lieblichem, pastoralem oder ganz allgemein grazioso Charakter, weil man ihn mit der Vorstellung verband, dass Gott kurz davor in der Wandlung auf dem Altar gegenwärtig geworden ist – so wie Jesus als Kind zur Erde gekommen ist. So wie damals die Hirten das Kind im Stall zu Bethlehem angebetet haben, so beten nun die Gläubigen, die sich zur Messe versammelt haben, den Herrn auf dem Altar an. Ganz anders Haydn in dieser Messe: Hier hat das Benedictus imperialen Charakter, für den statt der in der Kirchenmusik üblichen zwei Trompeten drei Trompeten sorgen, ganz abgesehen von der thematischen Erfindung und der grundsätzlichen Konzeption des Satzes. Hier wird nicht ein Kind angebetet, sondern der Weltenherrscher verherrlicht. Die Zeitgenossen waren erstaunt, die Nachwelt war verwirrt von diesem Satz. Man suchte eine Erklärung für den ungewöhnlichen Charakter dieses Benedictus und fand sie in einer Legende: Haydn soll bei der Komposition dieses Satzes an den in vielen Seeschlachten erfolgreichen Admiral Lord Nelson gedacht und ihm sozusagen zugerufen haben „Hochgelobt sei, der da kommt“. Nun, Nelson hat Haydn tatsächlich einmal in Eisenstadt besucht, aber diese Messe hat weder mit Lord Nelson im Allgemeinen noch etwas mit dessen Besuch bei Haydn zu tun.
(Text aus: Otto Biba „Die Kirchenmusik von Joseph Haydn“)
Als Solisten hören Ursula Langmayr, Martina Steffl, Gernot Heinrich und Klemens Sander.